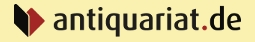Glossar
Wählen Sie einen Buchstaben:
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Alfapapier
Ein hochwertiges, weiches und voluminöses Papier. Besonders wenig durchscheinend (opak) und relativ unempfindlich für Verformung durch Luftfeuchtigkeit (maßhaltig). Wegen kurzer Fasern aber nicht sehr reissfest. Der Rohstoff Alfa- oder Espartogras wächst im westlichen Mittelmeerraum und in Nordafrika, deshalb wird es auch Spanisches- oder Tripolisgras genannt.
Alinea, Alineazeichen
(lat. a linea = "von der Linie weg, von der Linie an") Ein Zeichen das einen Absatz einleitet. In alten Drucken wurde häufig das Paragraphenzeichen als Alineazeichen verwendet, in der Frührenaissance war ein Zeichen in der Form eines Blatts beliebt. Für Pressendrucke und andere buchkünstlerisch ausgestattete Werke wird diese Sitte gern als gestalterisches Mittel übernommen.
Altdeutsche Schrift
Ungenaue Bezeichnung gebrochener Schriften.
Alte Drucke
Im Antiquariat werden im allgemeinen Druckerzeugnisse aus der Zeit zwischen 1500 und 1700 als 'Alte Drucke' bezeichnet. Im Bibliotheksgebrauch (z.B. im Projekt der Bestands-Digitalisierung) wird der Begriff neuerdings gelegentlich bis 1800 oder gar 1830 ausgeweitet.
Anagramm (griech.)
Ein Wort, das durch die beliebige Umstellung der Buchstaben eines anderen Wortes entsteht. Wird gerne zur Bildung von Pseudonymen angewandt.
Analekten
Sammlung auserlesener Schriftstellen, Gedichte, Aufsätze, Denksprüche etc.
Anastatischer Druck
(griech. Anastase = "Wiedererweckung") Ein älteres Nachdruckverfahren, bei dem Drucke nach der Vorbehandlung (Anlösen der Druckfarbe) ohne Neusatz auf Stein- oder Metalldruckformen übertragen werden. Die Vorlage geht dabei verloren. Nur unter sehr günstigen Bedingungen sind befriedigende Ergebnisse zu erzielen. Deswegen meist nur für einzelne Seiten und geringe Auflagen angewandt.
Anonym
(griech. "namenlos") Ein Werk erscheint anonym, wenn weder ein Verfassername noch ein Deckname (Pseudonym) angegeben ist.
Anthologie
(griech. "Blütenlese") Eine aus verschiedenen Werken verschiedener Autoren zusammengestellte Auswahl. Häufig unter einem bestimmten Motto.
Antiphonar
(griech.-lat.) Eigentlich eine Sammlung von Antiphonen, das sind Wechselgesänge zwischen zwei Chören. In der Regel versteht man darunter jedoch eine Sammlung von (katholischen) Kirchengesängen, nach Festzeiten geordnet.
Antiqua
(lat. "Altschrift") Rundbogige (westeuropäische) Druckschriften, im Gegensatz zu den gebrochenen Schriften. Heute die am weitesten verbreitete Schriftgattung der westlichen Welt. Entstand als Schriftart der italienischen Renaissance um 1460. Vorbild für die Großbuchstaben war das Alphabet der antiken Inschriften, für die Kleinbuchstaben die karolingische Minuskel. In Deutschland lange Zeit nur für fremdsprachliche Texte eingesetzt. Unter dem Einfluss der Brüder Grimm fand die Antiqua im 19. Jahrhundert zunächst Eingang in fast alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist auch die schöngeistige Literatur durchweg in Antiqua gedruckt.
Apart
bedeutet im Buchhandel soviel wie einzeln. Steht z.B. für den Bezug einzelner Stücke von periodischen Reihen oder mehrbändigen Werken.
Apud
(lat.) Kommt in alten Drucken oft in Zusammenhang mit dem Namen des Verlegers vor und steht dann für "zu bekommen bei ?".
Aquatinta
(lat.-ital. "Tuschmanier") Ein Verfahren der Radierung, bei dem Asphalt- oder Kolophoniumstaub auf die Platte gestäubt und angeschmolzen wird, so dass die Säure nur die freien Stellen anätzen kann und Punkte stehen bleiben. Durch Abdecken und stufenweises Ätzen können verschiedene Tiefen und damit unterschiedlich dunkler Druck mit der Wirkung von Tuschzeichnungen erzielt werden.
Außensteg
Soviel wie Außenrand. Stege heißen in der Buchdruckerei (bzw. beim Schriftsatz) die zum Füllen von Leerräumen verwendeten Metallstücke. Der Begriff wird deshalb für die im fertigen Buch als Leerräume erscheinenden Stellen, insbesondere die Ränder verwendet.
Ausgabe letzter Hand
Die letzte Ausgabe eines Werks, die noch vom Verfasser selbst herausgegeben wurde und damit seinen Wünschen hinsichtlich der Textgestaltung entspricht.
Autograph
(griech. "Selbstschrift") Schriftstück, das vom Verfasser mit eigener Hand niedergeschrieben wurde.
Autopsie
(griech. 'Augenschein') Die Überprüfung eines Werks auf Vollständigkeit, z.B. durch Kollation. Bei bibliographischen Angaben bedeutet Autopsie, dass diese nicht aus einem Katalog übernommen, sondern am Objekt überprüft wurden.
Autorisierte
Ausgabe nennt man eine mit dem ausdrücklichen Einverständnis des Verfassers vom Verleger herausgegebene Ausgabe.
Autotypie
(oder Netzätzung) . Halbtonbilder (das sind alle gerasterten Abbildungen im Buchdruck), die von einem photomechanisch hergestellten Druckstock im Hochdruckverfahren entstanden sind. Die Autotypie erfand Georg Meisenbach im Jahr 1881.
→ nach obenBauchbinde
Ein Streifen meist auffällig gefärbten Papiers, der um das Buch gelegt wird und durch eine ebenfalls auffällige (oft provokante) Beschriftung zum Kauf anregen soll.
Beiheft
Nachträge zu größeren Werken, Erläuterungen, Register können in so genannten Beiheften herausgebracht werden. Bei Zeitschriften werden umfangreichere Beiträge gelegentlich als Beiheft, außerhalb des Abonnements, veröffentlicht.
Beschneiden
Üblicherweise wird ein Buchblock nach dem Heften an drei Seiten beschnitten. Dies dient einerseits dazu, die noch zusammenhängenden Bogen zu öffnen, andererseits ermöglicht es ein leichtes Blättern. In angelsächsischen Ländern wird der Block oft nur am Kopf beschnitten. Broschierte Bücher kamen früher häufig unbeschnitten in den Handel.
Bibel(druck)papier
Möglichst dünnes, aber nicht durchscheinendes Papier (vgl. Dünndruckpapier), vorzugsweise für den Druck umfangreicher Werke (Bibel, Wörterbücher, Klassikerausgaben).
Bibliographie
(griech. "Bücherbeschreibung") Bücherverzeichnisse. Allgemeine Bibliographien verzeichnen Publikationen ohne Rücksicht auf fachliche Zugehörigkeit. Im Unterschied dazu gibt es Fachbibliographien, Nationalbibliographien und Personalbibliographien.
Biernägel
Bücher, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie auf schmutzigen oder nassen Oberflächen liegend benutzt werden (Kommersbücher, Kochbücher), sind manchmal auf den Deckeln mit Ziernägeln versehen, deren große bucklige Köpfe eine Berührung des Einbands mit der Auflagefläche verhindern. Da dies besonders bei den Kommersbüchern der Corpsstudenten beliebt war, nennt man diese Biernägel.
Blattweiser
Die zum Auffinden des Beginns bestimmter Abschnitte oder Textstellen am seitlichen Rand der Blätter angeklebten Streifen aus Leder oder farbigem Papier.
Blindendruck
Die Vervielfältigung von Werken für das Lesen durch Blinde. Nach einzelnen frühen Versuchen konnte sich die durch Louis Braille (1809-1850) erfundene Blindenschrift (Brailleschrift) allgemein durchsetzen. Sie besteht aus einem System von sechs unterschiedlich stark ausgeprägten Punkten, die in zwei Reihen angeordnet sind.
Blindpressung
Verzierung von Bucheinbänden ohne Farbe oder Gold mit Hilfe metallischer Stempel. Die Blindpressung bzw. den Blinddruck, der auf Papier ausgeführt wird, nennt man Prägedruck.
Blockbücher
heißen Bücher, bei denen die Druckform für eine ganze Seite aus einer Holztafel geschnitten ist, also keine beweglichen Lettern verwendet werden. Die Bebilderung ist in Blockbüchern vorherrschend. Das Papier kann dabei nur einseitig bedruckt werden. Auf zwei bedruckte Seiten folgen demnach zwei leere, die meist am Außenrand noch zusammenhängen. Die dadurch entstehende Bindeform wird Blockbuchbindung genannt. Sie ist häufig bei japanischen Büchern zu finden
Bogen
Kurzwort für Druckbogen.
Bogensignatur
In den meisten Büchern sind auf der ersten und dritten Seite jedes Druckbogens am unteren Rand kleine Ziffern bzw. Buchstabenkombinationen zu finden, dies wird als Signatur bezeichnet. Sie ist für den Buchbinder wichtig, um die richtige Reihenfolge zu finden und die Vollständigkeit zu prüfen. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts sind es meist Ziffern, zuvor wurden die Bogen bzw. Lagen durch Buchstaben gekennzeichnet: A-Z, wobei U+V als ein Buchstabe galten und J und W nicht verwendet wurden. Auf Z folgte AA-ZZ oder aa-zz. Die ebenfalls am unteren Rand stehende kurze Angabe des Buchtitels heißt Norm.
Brokatpapiere
(auch Goldbrokat oder Augsburger-Papier genannt) gehören zu den edelsten Buntpapieren. Bei ihnen wurde das Muster (manchmal auch als Negativ) mit Blattgold oder anderem Blattmetall aufgedruckt. Ihre Blütezeit lag um 1720, und im Gegensatz zu anderen Buntpapieren findet man bei ihnen recht häufig Herstellerangaben. In dieser Technik wurden auch viele Motivbogen (Heiligenbilder, Blumen, Tiere, Jagdszenen, Kostümbilder etc.) aber durchaus auch streng geometrische Ornamente angefertigt. Obwohl für die Druckformen Kupfer- oder Messingplatten verwendet wurden, handelt es sich nicht um ein Tiefdruck-, sondern um ein Hochdruckverfahren. Durch den hohen Anpressdruck unter der Walzenpresse wurde das Blattmetall fest mit dem Papier verbunden, überstehende, nicht zum Muster gehörende Teile konnten danach abgebürstet werden. Durch zusätzliche leichte Schraffierung oder durch Punzen konnte im Blattmetall eine Prägestruktur erzielt werden. Als Grund war einfach gestrichenes Papier beliebt, aber auch mittels Schablonen mehrfarbig vorkoloriertes "patroniertes" Papier ist zu finden. Wurde kein Metall verwendet sondern mit metallischer Farbe gedruckt, spricht man von Bronzefirnis-Papier. Auf einfarbigen (in seltenen Fällen mehrfarbigen) Grund wurde das Muster vom Holzmodel mit Goldbronze versetztem Firnis gedruckt. Der Druck mit diesen Farben ist schwierig, die Linien wirken relativ weich, oft leicht verschmiert oder sie haben ein körniges Aussehen. Sie hatten nur eine kurze Blütezeit von ca. 1690-1720. Mit dem Aufkommen der Lithographie im 19. Jahrhundert und später des Offsetdrucks gibt es aber wieder Papier mit ähnlichem Aussehen.
Broschur
Zu einem Heft oder Buch vereinigte Druckbogen, die nur geheftet und in einen Umschlag geleimt sind. Auch umfangreiche Bücher werden oft mit einem Interimsumschlag als Broschur ausgeliefert. Der Besitzer kann sie dann nach eigenem Geschmack binden. Der Begriff deckt sich nicht unbedingt mit dem der Broschüre.
Broschüre
Ein broschiertes Schriftwerk mit wenigen Bogen Umfang. Der Inhalt ist vielfach nur für die unmittelbaren Zeitgenossen von Bedeutung. Meist sind es kulturelle, politische, religiöse oder wirtschaftliche Kampf- oder Aufklärungsschriften.
Buchblock
Der gesamte Innenteil des Buches, also alle Papierblätter ohne die Einbanddecken.
Buchdecke
(Decke, Einbanddecke) Der aus den beiden Buchdeckeln und dem Rücken bestehende Einband.
Buchdruck
Gleichbedeutend mit Hochdruckverfahren (im Gegensatz zu dem z.B. für den Kupferstich verwendeten Tiefdruckverfahren. Der Satz wird aus beweglichen Lettern zusammengefügt, die hochstehenden Teile der Druckform sind die druckenden Teile. Heute werden Bücher nicht mehr im Buchdruck sondern überwiegend im Offsetdruck (Flachdruckverfahren) hergestellt. Den Buchdruck gab es in Asien und Europa bereits vor Gutenberg. Der Druck von eingefärbten Platten (Holz oder Stein), auch der von Texten war bekannt (Reibedruck). Bildholzschnitte, Blockbücher, Einblattdrucke und Spielkarten wurden auf diese Weise hergestellt. Der Mainzer Johann Gutenberg gilt als Erfinder des Buchdrucks, weil er um 1450 ein vollständig durchdachtes, umfassendes System vom Letternguss bis zum Druck entwickelte.
Buchschmuck
wird hauptsächlich als Sammelbezeichnung für die künstlerische, ornamentale Ausgestaltung eines Buches gebraucht, wie sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts üblich war (Vignetten, Initialen, Bordüren).
Buntpapier
ist grundsätzlich jedes Papier, das auf einer oder auf beiden Seiten ein- oder mehrfarbig gemustert ist. Papier, das bereits während der Herstellung durchgehend gefärbt wird (= farbiges Papier), gehört nicht dazu. Die als Sammel- und Forschungsobjekt begehrtesten Buntpapiere stammen aus der Zeit vor 1800. Doch auch spätere Papiere sind reizvoll, denn abgesehen von ihren attraktiven Mustern sind sie oft in handwerklichen Originaltechniken gefertigt und weisen Strukturen und Feinheiten auf, die drucktechnisch nicht zu erzielen sind. Buntpapiere finden sich im Zusammenhang mit Büchern als Vorsatz, als Bezugsstoff für Einbände, Schuber und Schatullen oder als Umschlag für Broschüren. Es gibt zwar zeitliche und regionale Vorlieben für bestimmte Muster und Techniken, in der Verwendung für die Buchausstattung sind die Grenzen aber fließend. Auch alte Techniken werden immer wieder aufgegriffen. Die Benennungen richten sich überwiegend nach dem Aussehen und den Herstellungsmethoden (siehe Brokat-, Glanz-, Imitations-, Kattun-, Kleister-, Marmor, Metall- und Spritzpapier). Es gibt wohl kaum eine Technik, mit der man nicht versuchte, Buntpapier herzustellen. Von Kunsthandwerkern oder auch namhaften Künstlern handbemaltes Buntpapier (z.B. mit Batiktechniken oder Pochoirkolorit) fand bei kleinen und kleinsten Auflagen außerhalb der regulären Verlage Verwendung. Halbindustriell gefertigte Kleisterpapiere, geknitterte und in Farbe getauchte Papiere und eine Vielzahl gedruckter Buntpapiere wurden Anfang des 20. Jahrhunderts sogar bei großen Buchproduktionen verwendet. Die Pappbände der Insel-Bücherei sind typische Vertreter. Durch Einfügen zusätzlicher Arbeitsschritte und Verwendung besonderer Farben (besonders Metallfarben) sind selbst bei den maschinell gedruckten Papieren besondere Effekte zu erzielen. Der Anwendungsbereich von Buntpapier geht weit über das Buchgewerbe hinaus.
→ nach obenCartons
(franz.). Nachträglich gedruckte Ergänzungs- oder Ersatzblätter. Cartons werden hergestellt, wenn aus irgendwelchen Gründen, z.B. Zensur oder später festgestellte größere Fehler, eine Korrektur oder Ergänzung notwendig ist. In fertige Bücher werden die Cartons vom Buchbinder eingeklebt. Bei so genannten Titelausgaben wird das alte Titelblatt entfernt und ein neues in Form von Cartons eingeklebt. Vgl. auch Tektur.
Census
Verzeichnis aller Exemplare eines Buchs, z.B. bei seltenen Werken (Gutenberg-Bibel oder De Revolutionibus Orbium Coelestium des Nikolaus Kopernikus u.ä.) üblich. Der Census gibt stets auch die Standorte der verzeichneten Exemplare an.
Chagrin
(franz., von türk. zâgri = "Eselsrücken"). Eigentlich die Bezeichnung für Esels- und Maultierleder mit kleiner und körniger, künstlich aufgepresster Narbe. Wenn sonstige Einband-Überzugsstoffe mit einer ähnlichen Prägung versehen sind, werden sie dementsprechend bezeichnet, z.B. als Chagrinpapier.
Chalkographie
(griech. chalkos = "Kupfer"). Soviel wie Kupferstich bzw. Kupferstechkunst.
Chamois
(franz. "Gemse"). Weiches Gemsleder, häufig zum Ausfüttern der Schuber verwendet. Daraus abgeleitet als Farbbezeichnung für schwach gelblichbraunes Papier gebräuchlich.
Chinapapier
Besonders weiches, saugfähiges, meist leicht gelbliches Papier, das hauptsächlich für Kupferstiche, insbesondere für Radierungen verwendet wird. Nicht zu verwechseln mit dem eigentlichen chinesischen Papier aus Reisstroh und ähnlichen Rohstoffen. Um besonders feine Abzüge zu erzielen, wird auf den Kupferdruckkarton vielfach ein angefeuchtetes, mit Kleister bestrichenes Blatt Chinapapier aufgelegt, das sich beim Druckvorgang fest mit dem Untergrund verbindet. In Antiquariatskatalogen meist als aufgewalztes China bezeichnet.
Chrestomathie
Auswahl aus Schriftstellern, Musterstücken besonders für den Unterricht.
Chromo-
(griech.-lat.-franz. chrom-). Soviel wie Farbe, farbig. Vor allem als Chromolithographie für die mehrfarbige Lithographie geläufig, aber auch in anderen Zusammensetzungen üblich. Chromopapier ist einseitig gestrichenes Papier für Stein- oder Offsetdruck. Der Strich, oft etwas glänzend und in zarten Farben (gelb, hellblau, rosa), ist meist ein deutlich sichtbarer Auftrag, mitunter unter Zusatz von Kreide. Chromotypie bezeichnet den Druck farbiger Autotypien (Drei- oder Vierfarbdruck). Im weiteren Sinn jeder farbige Druck.
Chromolithographie
Mehrfarben-Steindruck, bei dem anders als beim Drei- oder Vierfarbdruck jede Farbnuance einzeln ausgedruckt wird. Der Lithograph muss mit viel Farbgefühl die Vorlagen oft auf 15 bis 20 oder mehr lithographische Steine aufteilen. Die Farbbilder bewahren dadurch ihren originalgraphischen Charakter. Vielfach wird allerdings der farbige Flachdruck allgemein als Chromolithographie bezeichnet, also z.B. auch Zink- und Offsetdruck mit Farben.
Corrigenda
Soviel wie Druckfehlerverzeichnis.
Cul-de-lampe
Verzierung (Vignette) am Schluss eines Buches oder Kapitels. Der Name entstand aus der Form: meist ein nach unten spitz zulaufendes Ornament, das an einen umgedrehten Lampenfuß erinnert.
→ nach obenDedikation
In der gedruckten Form ist die Dedikation (Widmung) häufig Bestandteil alter Bücher. Zu Zeiten, in denen Autorenhonorare noch nicht üblich waren, wurden Widmungen an Fürsten, kirchliche Würdenträger oder andere einflussreiche Persönlichkeiten dem Buch in der Hoffnung vorangestellt, einen Gönner zu finden und eine materielle Gegengabe zu erhalten. Auch eine Vorrede an das Publikum konnte diesem Zweck dienen. Sind von der Obrigkeit erteilte Sonderrechte abgedruckt, so nennt man dies Privileg.
Dedikationsexemplar
Soviel wie Widmungsexemplar.
Diazotypie
Ein Lichtpausverfahren.
Doppeltitel
Der Ausdruck wird heute vorwiegend für aufwendig gestaltete, aus ästhetischen Gründen doppelblattgroße Titel bei Pressendrucken gebraucht. Ursprünglich war der bei zweisprachigen Büchern oder Reihenwerken zu findende Parallel- oder Nebentitel damit gemeint.
Doppeltondruck, Duoton
Um beim Druck von einfarbigen Abbildungen einen luxuriösen Eindruck zu erzielen, verwendet man Doppeltonfarbe. Diese enthält eine fettlösliche Farbbeimischung, die während des Trocknens ausläuft und um einzelne Rasterpunkte einen Hof bildet. So erhält das Bild einen warmen, weichen Ton, der den Eindruck einer zweiten Farbe erweckt (vgl. Duplex).
Doublure
Einbände, bei denen auch die Innenseiten der Deckel (die Spiegel) in die Ausschmückung einbezogen sind ("Verdoppelung des Einbands"). Sie können mit Leder überzogen (reliure double) und in Handvergoldung verziert sein. Bei Einbänden des 18. Jahrhunderts wurde häufig Seide verwendet, die von einem breiten, goldgeprägten Rahmen eingefasst ist. Die englische Doublure (Sutherland binding) setzte weißes, handvergoldetes Pergament in den Spiegel.
Druckermarke
Vorläufer des Verlagssignets. Bereits in den Inkunabeln zu findende ornamentale Zeichen der Drucker, die sich aus den mittelalterlichen Hausmarken entwickelten und in der Art und an Stelle von Siegeln verwendet wurden. Zunächst am Schluss angebracht, dann auch auf dem Titelblatt. Neben der Wappenform findet man häufig "redende" Signets, die auf den Namen des Druckers anspielen, oder solche mit den Initialen des Druckernamens. Im 16. Jahrhundert bevorzugte man emblematische Darstellungen.
Druckfehlerverzeichnis
(auch Errata oder Corrigenda genannt). Verzeichnis sinnstörender Fehler im Buch, die jedoch erst während oder nach dem Druck bemerkt worden sind. Das Druckfehlerverzeichnis ist entweder auf dem zuletzt gedruckten Bogen (häufig der Titelbogen) oder auf einem eigens beigelegten Zettel zu finden.
Dubletten
Doppelt vorhandene Bücher einer Bibliothek.
Dünndruck, Dünndruckpapier
Dünndruckpapier ist ein feines, stets holzfreies, außerordentlich dünnes Papier, das nicht durchscheinen darf. Besonders feines Dünndruckpapier bezeichnet man auch als Bibel(druck)papier.
Duodez
(lat. duodecim = "zwölf"). Formatbezeichnung, auch 12° oder 12vo geschrieben. Die Bezeichnung rührt daher, dass der Druckbogen zu zwölf Blättern gefaltet wird, wobei ein sehr kleines Format entsteht.
Duplex
Von zwei Platten gedruckte (eigentlich einfarbige) Abbildung. Um ein plastischeres Bild zu erreichen, wird zu einer gewöhnlichen, kontrastreichen Platte (Schwarz- oder Zeichnungsplatte) eine zweite - die so genannte Tonplatte - in einem anderen (wesentlich weicheren) Tonumfang hinzugefügt, für die man eine zweite Farbe verwendet (Doppeltondruck, Duoton).
Durchschlagen
Das Durchschlagen der Druckfarbe von der einen Seite des Papiers auf die Rückseite ist ein Zeichen für mangelhaften Druck infolge schlechter Farbabstimmung auf die Papierbeschaffenheit. Nicht zu verwechseln mit dem Durchscheinen, das entsteht, wenn die gewählte Papiersorte eine zu hohe Transparenz aufweist.
Durchschuss
Soviel wie größerer Zeilenabstand.
→ nach obenEckbeschläge
Einbände alter, großformatiger Bücher sind gelegentlich an den Ecken zum Schutz mit Metallbeschlägen versehen, häufig im Zusammenhang mit Schließen und ebenso verziert wie diese. Hauptsächlich finden sich solche Beschläge bei Büchern, für die eine Aufbewahrung in Regalen nicht üblich war (Kettenbücher, liturgische Bücher, Bibeln etc.)
Ecraséleder
Farbiges, pflanzlich gegerbtes, grobnarbiges Ziegenleder. Beim Färben mit Schwamm und Bürste erhalten nur die Wölbungen Farbe. Nach dem Glätten werden die Ecraséleder durch Bügeln auf Hochglanz zugerichtet, die ungefärbten Stellen sind dann als feine Adern zu sehen.
Editio princeps
Erstausgabe. Der Begriff wird überwiegend für die frühesten Ausgaben griechischer und lateinischer Klassiker und Inkunabeldrucke gebraucht, selbst wenn es sich dabei um eine noch unvollständige Textausgabe handelt.
Einbanddecke
Ein vorgefertigter Einband ohne Inhalt. Bei Werken die über einen längeren Zeitraum in Lieferungen erscheinen ist es üblich, dass vom Verlag auch eine Einbanddecke geliefert wird in die dann mehrere Lieferung zu einem Band zusammengefasst vom Buchbinder eingehängt werden können.
Einblattdruck
Einseitig bedrucktes Blatt: Ablassbrief, Kalender, Buchhändleranzeige, Flugblatt und ähnliche Mitteilungen, die vom Buch streng zu unterscheiden sind. Die Einblattdrucke stehen hoch im Wert, weil sie sich immer nur in wenigen Exemplaren und durch Zufall erhalten haben.
Einhängen
nennt man das Einpassen und Einkleben des Buchblocks in die vorher fertig bearbeitete Buchdecke (den Einband).
Einschaltblatt
Einschalttafel. In eine bereits nummerierte (paginierte) Folge eingefügtes zusätzliches Blatt bzw. jegliche Tafel außerhalb der Pagination (das grundsätzliche Charakteristikum der Tafel). Für die Nummerierung, Paginierung des Einschaltblatts wird häufig die Nummer des vorausgehenden Blatts mit dem Zusatz * oder bis wiederholt.
Elefantenhaut
Ein zähes Papier mit typischer Aderung. Weitgehend scheuerfest. Besonders beliebt für Urkunden und Speisekarten, findet aber auch für Buchumschläge und Vorsatzpapiere Verwendung.
Emblemata
Im Zusammenhang mit Büchern ist mit Emblem immer ein Sinnbild gemeint: die bildliche Darstellung eines Begriffs und dessen Erklärung. Im Barock umfasste das Emblem drei Teile: Inscriptio (eine abstrakte Überschrift), Pictura (das Sinnbild, meist ein Holzschnitt oder Kupferstich), Subscriptio (ein Epigramm, das den Zusammenhang zwischen Inscriptio und Pictura erhellt). Emblemata sind Sammelausgaben von Mustersinnbildern, die Künstlern (Malern, Goldschmieden) als Vorlagen dienten oder die als Erbauungsbücher benutzt wurden.
Englische Broschur
Eine für bibliophile Publikationen beliebte Art des Interimseinbands, benannt nach den Interimskartonagen englischer bibliophiler Vereinigungen. Die englische Broschur besteht aus leichter Heftung der Bogen auf Bänder, ohne Leimung, und einer überstehenden, mit einfarbigem Papier bezogenen Decke von Pappe mit hohlem Rücken.
Ephemera
(griech. "vorübergehend, kurzfristig"). Sammelbegriff für Kleinschriften und Gegenstände, die eigentlich dem kurzlebigen Alltagsgebrauch zuzurechnen sind, in besonderen Fällen aber als sammelwürdig erachtet werden: Notizzettel, Eintrittskarten, Programmhefte, Ausweise, Anzeigenzettel, Briefköpfe, Reklamemarken etc.
Erbauungsbuch
Ein Buch für häusliche, stille Andachten, das es schon im späten Mittelalter gab (z.B. die Stundenbücher). Einen Aufschwung erfuhr die Erbauungsliteratur durch die Reformation. Die starke Differenzierung der Frömmigkeit im 19. Jahrhundert löste eine unübersehbare Flut von Erbauungsbüchern aus.
Errata
Soviel wie Druckfehlerverzeichnis.
Erscheinungsjahr
In den meisten Fällen ist das Erscheinungsjahr zusammen mit der Verlagsangabe auf dem Titelblatt zu finden. Als Erscheinungsjahr gilt der Zeitpunkt, zu dem die Vervielfältigung vom Inhaber des Verlagsrechts hergestellt und Dritten zugänglich gemacht wird. Ein Werk ist noch nicht erschienen, wenn Teile daraus in Zeitungen abgedruckt oder einige Exemplare "als Manuskript gedruckt" wurden. Es zählt also die mit den Mitteln des regulären Verlagsbuchhandels erfolgte Art der Veröffentlichung. Die Jahresangabe im Copyright-Vermerk kann nur mit großer Vorsicht als Erscheinungsjahr genannt werden, wenn die Angabe auf dem Titel fehlt.
Exlibris
(lat. "aus den Büchern"). Ein kleines Blatt Papier, das als Besitzanzeiger auf die Innenseite des vorderen Buchdeckels geklebt wird. Es enthält den Namen oder das Wappen des Besitzers, auch allegorische Darstellungen sind beliebt, und kann graphisch aufwendig gestaltet sein. Auf die künstlerische Herstellung der Exlibris wurde viel Eifer und Mühe verwandt. Neben seiner Beliebtheit als Sammelobjekt ist es für die Geschichte der Bibliophilie von großer Bedeutung: Noch nach Jahrhunderten gibt es die Zugehörigkeit eines Werkes zu einer bestimmten Sammlung zu erkennen.
Explizit
bedeutet soviel wie erklärt, ausführlich dargestellt. Dagegen: Explicit (Schlussschrift), vgl. Kolophon.
→ nach obenFadenheftung
ist die Verbindung der Blätter eines Bogens und der Bogen untereinander mit durch den Rückenfalz gezogenem Heftfaden. Wegen der besseren Benutzbarkeit des Buches und der höheren Dauerhaftigkeit ist sie der Klebebindung bzw. der Draht-, Klammerheftung gegenüber unbedingt vorzuziehen. Die Fadenheftung kann von Hand oder mit Maschinen ausgeführt werden.
Fahne, Fahnenabzug
Korrekturabzug vom noch nicht umbrochenen Satz. Auch Bürstenabzug genannt, weil er früher durch Abklopfen mit der Bürste gewonnen wurde.
Faksimile
(lat. fac simile = "mach ähnlich"). Wiedergabe von Originalvorlagen, besonders von Handschriften oder Druckwerken, die nur als Einzelstücke oder in extrem kleinen Stückzahlen vorhanden sind, mit sehr großer Originaltreue. Die schnell fortschreitende Reproduktionstechnik im 20. Jahrhundert vereinfachte dies enorm. Erst dann konnten Faksimiles in nennenswerter Zahl erscheinen.
Falz
Allgemeine Bezeichnung für jeden scharfen Knick oder Bruch in einem Werkstoff (nicht zu verwechseln mit Nuten oder Rillen). Ein Falz ist z.B. der "Knick", den ein Druckbogen beim Falzen (Falten) erhält. Als Falz wird auch ein einzelner gefalzter, geknickter Werkstoffstreifen bezeichnet, an den z.B. in Tafelwerken die Tafeln angeklebt sind.
Farbschnitt
Der eingefärbte Schnitt des Buches. Die Färbung wird durch verschiedene Techniken erreicht, meist einfarbig. Sie soll primär das Vergilben unterbinden und das Buch gegen das Eindringen von Staub abdichten. Neben dem einfarbigen Schnitt, bei älteren Büchern meist rot, gibt es auch Sonderformen wie Marmorschnitt, Sprengschnitt (gespritzter, punktierter Schnitt) und Goldschnitt. Früher waren fast immer alle drei Schnittseiten gefärbt, im 20. Jahrhundert war es häufig nur noch der Kopfschnitt. Zur weiteren Ausschmückung vgl. Fore-edge-painting und Punze.
Farbstich
ist ein in mehreren Farben gedruckter Kupfer- oder Stahlstich. Ganz korrekt wird unterschieden nach "Farbstich" als Bezeichnung für den farbigen Druck von mehreren Druckplatten (üblicherweise Mezzotintotechnik) und "Farbiger Stich" für den farbigen Druck von einer einzigen gestochenen Platte. Wird von einer Platte gedruckt, müssen die verschiedenen Bereiche dieser Platte mit unterschiedlichen Druckfarben eingefärbt bzw. regelrecht ausgemalt werden. Bekanntestes Beispiel sind die Rosendarstellungen von Redouté. Da es schwierig ist, den Farbauftrag exakt auszuführen, sind an den Übergängen von einer Farbe zur anderen häufig Vermischungen oder die nicht ganz genau mit dem Motiv übereinstimmenden Farbgebungen zu erkennen. Farbstiche wirken gegenüber kolorierten Stichen sehr leicht und elegant. Eine zweite Möglichkeit, farbige Drucke von gestochenen Motiven anzufertigen, ist der aufeinander folgende Druck in mehreren Farben. Auf Newtons Farbtheorie beruhend, wonach sich alle Farben des Spektrums aus drei Grundfarben (Rot, Gelb, Blau) zusammensetzen, erfand Christoph le Bon 1757 den Farbstich. Die Berechnung (Farbauszug) des Anteils der Grundfarben am Vollfarbton war sehr schwierig, deshalb waren oft mehr als die drei Grundfarben nötig. Man verwendete bis zu acht Farbplatten. Durch die Schwankungen, die das Ausdehnen und Zusammenziehen des für jeden Druckvorgang angefeuchteten Papiers bewirkt, entstehen besonders an den Rändern unweigerlich kleine Ungenauigkeiten. Die Anforderungen an den Stecher und Drucker bezüglich der Passgenauigkeit, der richtigen Linienführung, Schraffur und der richtigen Einschätzung der Farbeffekte etc. waren so enorm, dass es nur extrem wenige Druckereien gab, die in der Lage waren, solche Drucke herzustellen.
Filete
Wiegemesserförmiges Werkzeug des Buchbinders für die Blindprägung und vor allem für die Handvergoldung. Wichtig für das Prägen von Linien und schmalen fortlaufenden Mustern. Damit hergestellte Verzierungen werden ebenfalls als Fileten bezeichnet. Sie sind fast immer an den nicht ganz genau aufeinander passenden Nahtstellen zwischen zwei Abdrücken zu erkennen. Im Gegensatz zum Streicheisen wird die Filete hauptsächlich für den Golddruck verwendet.
Flachdruckverfahren
Beim Flachdruckverfahren werden die druckenden Teile so präpariert, dass sie beim Einfärben Druckfarbe annehmen und Wasser abstoßen. Die nichtdruckenden Teile reagieren entgegengesetzt. Zu den Flachdruckverfahren gehören Lithographie, Offsetdruck, Lichtdruck.
Flächenkolorit
Üblich bei der Beschreibung alter Landkarten. Sind die Länder (Gebiete, Landesteile) durch farbiges Ausmalen der gesamten Fläche gekennzeichnet, spricht man von Flächenkolorit. Dabei sind die Grenzen meist mit einem verstärkten Strich hervorgehoben. Im Gegensatz dazu steht das Grenzkolorit, bei dem nur die Landesgrenzen durch einen farbigen Strich hervorgehoben sind.
Fleuron
Soviel wie Vignette. Die reichen, friesartigen Verzierungen über den Kapitelüberschriften im Rokokobuch heißen Fleurons oder Kopfvignetten. Häufiger wird die Bezeichnung allerdings für die kleinen ornamentalen Zierstempel auf Bucheinbänden, besonders für die in den Ecken angebrachten, verwendet.
Fliegendes Blatt
heißt der Teil des Vorsatzes, der zwischen dem Buchdeckel und dem Buchblock frei beweglich ist.
Flugschriften
sind kleinere, fast immer geheftete oder broschierte Schriften, die zu Tagesfragen aller Art Stellung nehmen. Sie dienen in der Regel den Interessen einer Partei gegen eine andere auf wissenschaftlichem, religiösem oder politischem Gebiet. Flugschriften sind wichtige Geschichtsquellen für die Reformation, den Dreißigjährigen Krieg, die Französische Revolution.
Foliieren
Soviel wie Blattzählung. Die Foliierung ist ein Vorläufer der Seitenzählung.
Folio, Foliant
Eine Formatbezeichnung, abgekürzt fol. oder 2°. Beim Folioformat ist der Papierbogen nur einmal gefalzt, bildet also zwei Blätter. Beim klassischen Folioformat entsteht so eine Rückenhöhe von ca. 42 Zentimetern. Solche Bücher nennt man Folianten.
Fore-edge-painting
Eine auf den Schnitt (zusammen mit Goldschnitt) aufgebrachte Darstellung, die nur zum Vorschein kommt, wenn man die Blätter des Buchblocks leicht gegeneinander verschiebt. Auf jedem einzelnen Blatt befindet sich nur ein ganz schmaler bemalter Streifen am Außenrand, maximal 1 Millimeter breit. Im Zusammenspiel über den ganzen Schnitt ergibt sich dadurch eine (bzw. auf der Rückseite der Blätter und in die andere Richtung verschoben eventuell auch eine zweite) bildliche Darstellung. Das dargestellte Motiv passt normalerweise zum Inhalt des Buches.
Format
Mit dem Format wird die Größe eines Buches nach Höhe und Breite angegeben (nicht die Dicke). Die Formatangabe kann in Zentimetern erfolgen oder nach der klassischen Formel, die sich daraus ableitet, wie viele Blatt aus einem gefalzten Druckbogen entstehen. Da das Papier ursprünglich das Pergament als Schriftträger ablöste, gehen die Bogengrößen auf dessen Maß zurück, das durch die mögliche Nutzfläche einer Schafhaut begrenzt war. Für Druckbogen kann man von einem Format von ca. 45 x 60 (bis 50 x 70) Zentimetern ausgehen. Daraus ergeben sich: 1 x gefalzt = 2 Blatt = Folio (2°) 2 x gefalzt = 4 Blatt = Quart(o) (4°/4to) 3 x gefalzt = 8 Blatt = Octav(o) (8°/8vo) 4 x gefalzt zu 12 Blatt = Duodez (12°) 4 x gefalzt zu 16 Blatt = Sedez (16°) Das Oktavformat wird als Standard angesehen und braucht deshalb in der Beschreibung nicht genannt zu werden. Besonderheiten können durch Zusätze deutlich gemacht werden, z.B. quer-schmal-8vo (oder entsprechende Abkürzungen). Es gibt immer wieder Unklarheiten über die Reihenfolge der Werte für Höhe und Breite, die daher rühren, dass im graphischen Gewerbe die Breite zuerst genannt wird und sich diese Gewohnheit bis in die Buchproduktion auswirkt. Im Bibliothekswesen und damit sinnvollerweise auch im Antiquariat ist es jedoch anders: Hier wird die Höhe vor der Breite genannt. In bibliothekarischen Beschreibungen ist die Formatangabe für neuere Bücher inzwischen ganz verschwunden. Für die Beschreibungen von alten Drucken ist sie allerdings auch dort noch üblich und richtet sich ausschließlich nach der Rückenhöhe.
Fortsetzungswerk
Im Buchhandel alle Publikationen, die in mehreren Bänden oder Teilen (Heften, Lieferungen) in bestimmten, mehr oder minder regelmäßigen Zeitabständen erscheinen. Im Gegensatz zu den Periodika sind Fortsetzungswerke nach Umfang und Inhalt begrenzt. Im Bibliothekswesen kennt man als weitere Unterscheidung den Begriff der Serienwerke für Schriftenreihen bzw. regelmäßig erscheinende Publikationen wie Jahrbücher, Adressbücher, Kursbücher u.ä.
Fraktur
(lat."Bruch"). Im 16. Jahrhundert entstandene Schrift mit gebrochenen Formen. Das Wort wird für gewöhnlich als Oberbegriff für alle "gebrochenen Schriften" verwendet, streng genommen ist die Fraktur allerdings nur eine unter mehreren. Sie hat schlanke Gemeine (kleine Buchstaben) und meist breite Versalien (Großbuchstaben). Kennzeichnendes Merkmal sind die gespaltenen Oberlängen von h, k und l. Die meisten ihrer Versalien haben geschwungene Ansetzstriche, "Elefantenrüssel" genannt. Entgegen der allgemeinen Annahme waren Frakturschriften nicht nur in Deutschland, sondern z.B. auch in angelsächsischen Ländern verbreitet.
Franzband
(auch französischer Band). Seit dem 18. Jahrhundert gebräuchliche Bezeichnung für die nach französischer Art gebundenen feineren Kalbsledereinbände mit echten oder mindestens erhabenen Bünden und Rückenvergoldung. Heute oft gleichbedeutend mit Ganzlederband (Kalbsleder).
Frontispiz
(lat., auch Titelbild genannt). Eine ganzseitige Illustration gegenüber dem Titelblatt: ursprünglich meist allegorische Darstellungen, im 17. und 18. Jahrhundert dann Bilder des Verfassers und ab Mitte des 18. Jahrhunderts mehr und mehr bildliche Darstellungen aus dem Buchinhalt. Zunächst bezeichnete man als Frontispiz einen Holzschnitt, der das Titelblatt verzierte (Titelvignette). Mit dem Aufkommen des Kupferstichs als Illustrationstechnik eroberte sich das Titelbild einen selbstständigen Platz. Nur in seltenen Fällen ist auch das Titelblatt gestochen (Kupfertitel).
→ nach obenGaleriewerke
Ein Tafelwerk, das Abbildungen von Gemälden aus einer Kunstsammlung, einer Galerie, enthält.
Gaufriertes Papier
(franz. gauffer = "prägen"). Geprägtes Papier, in das eine Struktur oder ein feines Muster eingearbeitet ist. Hierzu gehören z.B. die als Briefpapier beliebten Leinenpapiere (Leinenstruktur). Im Antiquariatsbuchhandel sind meist die im 19. Jahrhundert als Vorsatz beliebten strukturierten Glanzpapiere gemeint.
Gebrauchsspuren
Als Zustandsbeschreibung üblich, wenn Beschädigungen aller Art und verschiedensten Grades vorliegen. Schmutzflecken, Abnutzung der Blattränder, Beschädigungen des Einbands, Besitzeintragungen usw.
Gebrochene Schrift
Sammelbezeichnung für alle lateinischen Schriften mit eckigen Grundformen. Vom typographischen Gesichtspunkt gelten diese als ausgewogener, da Versalien und Gemeine anders als bei den Antiquaschriften einen gemeinsamen Ursprung haben. Die ersten Druckschriften, Ableitungen aus liturgischen Handschriften wie der Textura oder Rotunda, gehörten ausnahmslos dazu. Aus den so genannten Kanzleischriften gingen etwas später die bekanntesten Vertreter der gebrochenen Schriften, die Schwabacher und die Fraktur, hervor. Zunächst waren sie in allen europäischen Ländern im Gebrauch; in England waren sie beispielsweise als Black Letter oder Gothic Type bekannt. Nach und nach dominierten aber die von den Humanisten bevorzugten Antiquaschriften. Nur in Deutschland konnten sich die gebrochenen Schriften länger halten.
Getrüffeltes Exemplar
Sind einem Werk zusätzliche Illustrationen beigebunden, die sich zwar auf den Inhalt beziehen, aber nicht im Zusammenhang mit dem Buch erschienen sind, spricht man von einem getrüffelten Exemplar.
Glanzpapier
eine Form des Buntpapiers. Im 18. Jahrhundert waren (einfarbige) Glanzpapiere beliebt, bei denen die Glanzwirkung durch einen Gelatineauftrag nach dem ersten Trockenvorgang zustande kam. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts experimentierte man zudem häufig mit Oberflächenveredelungen. Manchmal wurde durch Prägen und Stanzen ein Moiréeffekt erzielt, je nach Lichteinfall entstanden in den feinen Strukturen vielfältige Farbnuancen. Durch Auftragen von Fischschuppen oder Glimmerblättchen schuf man Perlmuttpapiere.
Glossar
Ein erklärendes, sachlich oder alphabetisch geordnetes Wörterverzeichnis. Ursprünglich bezeichnete Glosse ein schwer verständliches, erklärungsbedürftiges Wort bzw. die Übersetzung fremdsprachlicher (vorwiegend lateinischer) Wörter in die Volkssprache.
Gold gehöht
Bei besonders prunkvollem Kolorit wurden Teile durch eine Goldauflage oder zumindest Goldfarbe veredelt. Da diese beim Betasten als deutlich spürbare Erhebung fühlbar sind, spricht man von "Gold gehöhtem" Kolorit.
Goldschnitt
Ein mit Blattgold vergoldeter Buchschnitt, wie er beim künstlerischen Einband die Regel ist. Als Sonderform des Farbschnitts hat auch der Goldschnitt die Funktion, den Buchblock vor Vergilben und Staub zu schützen. Zur weiteren Verzierung wird der Goldschnitt gelegentlich ziseliert, gepunzt.
Grenzkolorit
Sind auf alten Landkarten nur die Gebietsgrenzen durch einen farbigen Strich hervorgehoben, spricht man von Grenzkolorit.
Großpapier
Wenn wertvolle bibliophile Werke auf handgeschöpftes Papier und besonders breitrandig gedruckt sind, spricht man von Großpapier. → nach oben
Hadernpapier
Ganz oder überwiegend aus Lumpen hergestelltes Papier. Teurer und dauerhafter als Papier aus Holz oder Stroh. Hadernpapiere für den Druck sind aus Baumwollfasern, Schreibpapiere eher aus Leinen.
Halblederband, Halbleinen, Halbpergament
Ein Halbband liegt dann vor, wenn der Buchrücken mit einem anderen Werkstoff bezogen ist als die Deckel. Die Bezeichnung des Einbands richtet sich nach dem Bezugsstoff des Rückens, z.B. Halbleder-, Halbleinen-, Halbpergament-Band.
Handvergoldung
nennt man das handwerkliche Verzieren des Bucheinbands mit Gold im Gegensatz zur maschinellen Pressvergoldung. Die Handvergoldung kann nur bei kleinen Mustern angewendet werden, denn für größere Flächen reicht der mit der Hand ausübbare Druck nicht aus. Hitze, Grundiermittel und Druck ermöglichen eine dauerhafte Verbindung zwischen dem Bezugsmaterial des Einbands und dem Gold.
Hardcover
Soviel wie fester, steifer Einband. Unspezifische Einbandangabe die sich leider in zunehmendem Maß in Buchbeschreibungen im Internet findet. Für die Beschreibung antiquarischer Bücher sollte unbedingt eine genauere Bezeichnung verwendet werden beispielsweise Ln./Lwd. (Leinen), Hln./Hlwd. (Halbleinen), Ldr./Hldr. (Leder/Halbleder), Pp. (Pappe) usw. Ursprünglich war die Unterscheidung Hardcover und Softcover oder Paperback bzw. im deutschen Sprachraum geb. (gebunden) und brosch. (broschiert) im Sortimentsbuchhandel üblich, wo eine solch grobe Unterscheidung sinnvoll und meist auch ausreichend ist. Der Antiquariatsbuchhandel stellt allerdings völlig andere Anforderungen, hier sind diese Bezeichnungen untauglich.
Heliogravüre
(griech., auch Photogravüre genannt). Ein Handpressen-Tiefdruckverfahren. Zunächst wird ein lichtempfindliches Pigmentpapier belichtet und in feuchtem Zustand auf die Druckwalze gequetscht. Wie beim Aquatintaverfahren ist die Platte mit aufgeschmolzenem Asphaltstaubkorn versehen. Das Trägerpapier lässt sich abziehen und die belichtete Gelatineschicht (das Diapositiv) bleibt allein auf der Druckplatte. Sie ist je nach Lichtwerten verschieden stark gequollen, in dunklen Partien dünn, in den hellsten am dicksten. In mehreren Eisenchloridbädern wird die Platte so geätzt, dass sie in den hellen Partien nur leicht angegriffen, in den dunklen dagegen tief geätzt wird. Nach Auswaschen und eventuell Nacharbeiten ist die Platte druckfertig. Der Druck erfolgt in der Handpresse, was große Auflagen ausschließt. Das Verfahren gestattet Drucke von außerordentlicher Schönheit und Originaltreue und zeichnet sich durch besondere Weichheit und Wärme des Tones aus. Es wurde 1878 von dem Wiener Maler Karl Klic erfunden. An die Stelle der Heliogravüre trat jedoch bald der ebenfalls von Klic entwickelte Rastertiefdruck.
Hochdruck
Sammelbezeichnung für Druckverfahren, bei denen die druckenden Teile der Druckplatte (z.B. die Buchstaben) gegenüber den nichtdruckenden erhaben sind, d.h. hochstehen. Es werden nur die erhabenen Teile mit Farbe eingewalzt, sie geben diese beim Druck auf das Papier ab. Durch den Druck werden die erhabenen Teile so auf bzw. ins Papier gedrückt, dass sie als schwache Prägung auf der Rückseite fühlbar sind. Im Gegensatz dazu stehen der Flach- und der Tiefdruck. Die bekanntesten Hochdruckverfahren sind der Buchdruck und der Holzschnitt.
Holzfreie-, holzhaltige Papiere
Holzfreie Papiere nennt man Papiersorten, die höchstens 5 Prozent Holzschliff enthalten. Da aber holzfreie Papiere trotzdem ausschließlich aus Holzzellstoff bestehen können, müsste die korrekte Bezeichnung eigentlich "holzschliff-frei" heißen. Papiere vergilben um so schneller, je höher der Holzschliffgehalt ist, dann werden sie auch brüchig. Ein Problem, das bei Büchern und besonders Kleinschriften aus der unmittelbaren Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg häufig auftritt.
Holzschnitt
Das älteste Illustrationsverfahren. Zur Herstellung wird auf ein Stück Holz das gewünschte Bild aufgezeichnet. Mit einem Messer fährt der Holzschneider links und rechts dieser Umrisslinien entlang. Dann wird alles, was im Abdruck weiß erscheint, ausgehoben. Die Zeichnung ist, bedingt durch die Faserung des Holzes, verhältnismäßig grob. Das Holz wird nun eingefärbt, das Blatt aufgelegt und durch Andrücken mit einem Ballen (Abreiben) oder in der Buchdruckerpresse gedruckt, wobei es sich so tief eindrückt, dass die Linien auf der Rückseite des Papiers deutlich als leicht erhaben fühlbar sind. Der Holzschnitt wurde zur Buchherstellung schon vor Johann Gutenberg in den Holztafeldrucken (vgl. Blockbücher) angewendet.
Holzstich
(griech. Xylographie = "Holzschneidekunst"). Diese spezielle Technik des Holzschnitts kam im 18. Jahrhundert auf. Dazu ist Hirnholz nötig: quer zur Faserrichtung aus dem Holzblock (meist Buchsbaum oder Akazie) geschnittene Tafeln. Der Holzstecher verwendet feine Grabstichel und hebt eng aneinander liegende Linien aus, weshalb auch nuancierte Schattenübergänge möglich sind. Werden dabei größere Flächen durch senkrecht aufeinander stehende Linienführung in Punkte verschiedener Größe aufgelöst, ähnlich dem Raster, spricht man auch von Tonschnitt.
Homonym
In der Sprachwissenschaft zwei gleichlautende Wörter. Im Antiquariatsbuchhandel der Deckname (Pseudonym), der aus einem klassischen Namen besteht (z.B.: Ajax = Johann Christoph Adelung / Laokoon = Wilhelm Edler / Triton = Adolf Goetz).
→ nach obenIlluminiert
(lat. "erleuchtet, geschmückt"). Illuminator hieß ursprünglich der Buchmaler im Mittelalter. (Für Überschriften und Zierbuchstaben gab es noch den Miniator und den Rubrikator.) Illuminierte Handschriften sind also bildgeschmückte Texte. Auch Holzschnitte wurden schon in frühester Zeit koloriert. War dabei eine besonders sorgfältige Farbgebung gewünscht, blieb auch diese Tätigkeit den Illuminatoren vorbehalten.
Imitationspapier
Eine Form des Buntpapiers bei dem durch Färbung und Prägung andere Werkstoffe (Schlangenhaut, Krokoleder, Holzmaserung, Vogelfedern etc.) imitiert wird. Hierzu gehört auch das Maroquinpapier, ein farbiges, stark glänzendes, durch Narbenprägung lederähnliches Papier.
Impressum
(lat. "Druckvermerk"). In Büchern auf der Rückseite des Titelblatts oder am Schluss des Bandes. Das Impressum gibt Auskunft über die Hersteller des Buchs: Drucker, Buchbinder; bei wertvolleren und bibliophilen Büchern werden auch die Herkunft des Papiers, der Gestalter von Einband und Umschlag, die verwendete Schrift sowie die für die typographische Gestaltung und Buch- und Bildschmuck Verantwortlichen genannt. Weitere Bestandteile des Impressums können Copyrightvermerk, Auflagenhöhe, Sonderausstattungen etc. sein. Die frühere Form des Impressums hieß Kolophon.
Inkunabel
(lat. in-cunabula = "Windeln, Wiege", daher auch "Wiegendrucke"). Bezeichnung für die ersten Drucke und Bücher, die von der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg (um 1450) bis zum Jahr 1500 (einschließlich) hergestellt wurden. Die Inkunabeln lehnen sich zunächst noch sehr eng an die Handschriften des Mittelalters und der Frührenaissance an. Sie weisen eine außerordentliche Mannigfaltigkeit auf, da sich die Gestalt des neuen, gedruckten Mediums Buch erst entwickeln musste. So hat jedes Buch der Inkunabelzeit noch seine ganz eigene Prägung, die es von jedem anderen deutlich unterscheidet. Teile der Druckausstattung (Kapitel- und Seitenüberschriften, Initialen usw.) wurden anfangs handschriftlich durch den Rubrikator ergänzt. Die Bezeichnung Inkunabel gebraucht man gelegentlich auch für die Erstlinge anderer Drucktechniken (Kupferstich, Radierung, Lithographie). Bei der Lithographie, wo ein genaues Erfindungsjahr bekannt ist, gelten die ersten 25 Jahre (1796-1821) als Inkunabelzeit.
Innenspiegel
Tautologische Bezeichnung für den Spiegel als Teil des Vorsatzes beim Buch.
Interimseinband, Interimsumschlag
(lat.). Ein vorläufiger Einband, der bis zur Ausführung des endgültigen Einbands das Buch schützen soll. Er muss möglichst fest sein, soll aber den Buchblock weitestgehend unverletzt lassen. Heute fast nur bei bibliophilen Drucken und gelegentlich bei Fortsetzungswerken üblich. In früherer Zeit, besonders vor dem Aufkommen des Verlagseinbands (im 19. Jahrhundert), war der Interimseinband jedoch weit verbreitet.
Italic, Italique
Englische bzw. französische Bezeichnung für die Kursive.
→ nach obenJapanpapier
Das echte Japanpapier wird aus der Rinde des Papiermaulbeerbaums im Handverfahren hergestellt. Durch Weichen im Wasser und Schlagen des Stoffbreis entstehen lange, seidenartige Fasern, die außerordentlich zähes und dennoch weiches Papier mit einer wolkigen (d.h. etwas ungleichmäßigen) Durchsicht ergeben. Echtes Japanpapier ist teuer, es gibt aber auch imitierte, aus Zellulose hergestellte Japanpapiere. Gute Leimung und verschiedene besondere Verfahren sind hierfür nötig. Auch bei diesen Papieren wird eine wolkige Durchsicht erzielt.
Juchtenleder
(auch Juften, russ: juft, engl.: Russia; franz.: cuir de Russie). Russisches Rinds- oder Kalbsleder, meist mit künstlich aufgepresster Narbe (Struktur). Der besondere Geruch des Juchentleders entsteht durch die Behandlung mit Birkenteeröl.
→ nach obenKaliko
Dünnes Baumwollgewebe, benannt nach der ostindischen Hafenstadt Calicut. Wird als Leinen-Ersatz häufig als Bezugsstoff für Bucheinbände verwendet. So gebundene Bücher werden einfach als Leinenbände bezeichnet.
Kalligraphie
Schönschrift, Schönschreibkunst. Der Kalligraph ist über das saubere, gleichmäßige Schreiben hinaus bemüht, die Buchstaben künstlerisch auszugestalten.
Kaltnadelradierung
Eine Radierung, die mit der trockenen (ohne nachherige Ätzung angewandten) Radiernadel entstanden ist. Die "kalte" Nadel wurde schon im 15. Jahrhundert verwendet. Die so erzeugten Linien sind schärfer als die der gewöhnlichen Radierung.
Kapital
Bezeichnung für den meist farbigen Zierstreifen aus Stoff an der Ober- und Unterkante des Rückens des Buchblocks (Kopf und Schwanz). Das Kapital soll zur Verzierung des Buches beitragen und vor allem die Lücke zwischen Buchrücken und Buchblock decken. Ursprünglich wurde das Kapital vom Heftfaden gebildet, der aus dem Rückenfalz heraustrat und in die nächste Lage überging. Um die Lage nicht einzureißen, unterlegte man einen Leder- oder Pergamentstreifen, der vom Heftfaden umstochen und wie ein Bund behandelt wurde, d.h. mit den Enden in die Deckel versenkt. Heute ist das Kapital für gewöhnlich ein farbiges, gewebtes Band, das angeklebt wird. Das gewebte Band kam bereits Anfang des 18. Jahrhunderts auf.
Kapitälchen
Nennt man Buchstaben einer Schrift von der Form der Versalien (große Buchstaben) und der Größe der Gemeinen (kleine Buchstaben). Sie finden z.B. bei Kapitelüberschriften Verwendung.
Karton, Kartonage, kartoniert
Kartons, auch Feinpappe oder Steifpapier genannt, sind Papiere mit einem Quadratmetergewicht von ungefähr 150 Gramm (Postkartenkarton) bis 500 Gramm. Die Grenzen sind jedoch fließend. Wird solches Papier als Umschlag verwendet, spricht man von einem kartonierten Druckwerk. Das Material des Umschlags bestimmt die Bezeichnung (mit zunehmender Steifheit): Umschlag, Broschur, "kartoniert" oder Pappband, was buchbinderisch nicht völlig korrekt ist, denn dort gibt es z.B. auch Steifbroschuren.
Kartusche
(franz. cartouche = "Hülse, Patrone"). Ornamentaler Zierrahmen für Überschriften, Inschriften, Embleme, Marken usw. Insbesondere im Barock und Rokoko gebräuchlich. Bei alten Landkarten sind Kartenbezeichnung und Legende meist als schmückendes Element in Kartuschen untergebracht.
Kaschieren
(franz. "verdecken, verbergen"). In der Buchbinderei allgemein gebräuchliche Bezeichnung für das Überkleben (Überziehen) von Pappe mit Papier (oder einem anderen Werkstoff).
Kattun- oder Holzmodelpapiere
Eine große Gruppe der Buntpapiere. (Kattun = Cotton = Baumwolle). Sie wurden mit Holzmodeln (die für Stoffdruck nicht mehr brauchbar waren und billig erworben wurden) und Kleisterfarbe mehrfarbig gedruckt. Die Zahl der Muster und der Hersteller ist bei diesen Papieren sehr groß, vor allem zwischen 1750 und 1800. Besonders häufig sind Blumenmuster. Um eine Sonderform handelt es sich bei Samt- oder Velourspapier. Solche Papiere mit einer samtartigen Farbschicht entstehen, wenn die Fläche geleimt bzw. das Muster ohne Farbe mit Leim aufgetragen und dann sofort mit farbigem, faserigem Material (häufig wurde Wollstaub verwendet) bestreut wird.
Kettenbuch
Ein zum Schutz gegen Diebstahl und Herabfallen mit einer Kette versehenes Buch, das am Lesepult bzw. an einer quer über die Pulte laufenden Eisenstange befestigt ist. Im Mittelalter war das Kettenbuch sehr verbreitet, doch schon im 16. Jahrhundert war es nur noch selten anzutreffen.
Klappentext
Der auf der vorderen und hinteren Einschlagklappe des Schutzumschlags stehende (Werbe-)Text.
Klebebindung
Für Bücher mit vielen Tafelbeilagen, verschiedenen Papiersorten, Trennkartons usw. ist die Klebebindung gegenüber anderen Heftarten vorteilhaft. Die Druckbogen werden am Rücken beschnitten, so dass lose Blätter entstehen, die Schnittfläche aufgeraut und geleimt. Erst in neuerer Zeit stehen hierfür alterungsbeständige Klebstoffe zur Verfügung. Bei den vor ca. 1980 in dieser Technik gebundenen Büchern wird der Klebstoff leicht spröde, weshalb die Blätter sich lösen.
Klein-Oktav, Klein-Quart
Formatbezeichnungen (siehe dort).
Kleisterpapier
eine einfache Form des Buntpapiers. Farbe wird dafür mit Kleister vermischt so aufgetragen, dass Strichspuren von Pinsel oder Bürste bzw. bei einem Schwammauftrag dementsprechende Strukturen sichtbar bleiben, spricht man von Kleisterpapier. Die Strichspuren können geradlinig oder in Wellen verlaufen, mit einem Schwamm lassen sich auch "wolkenförmige" Muster erzeugen. Die speziell als Wolkenmarmor bezeichnete Form des Kleisterpapiers entsteht jedoch auf andere Weise. Dazu werden zwei frisch mit Farbe bestrichene Bogen gegeneinander gedrückt und dann wieder abgezogen. In die frische Kleisterfarbe können mit Finger, Holzstab, Kamm, Holzmodel und sonstigen Stempeln (negative) Muster eingezeichnet werden. Zu dieser Art gehören die nach ihrem Herstellungsort (1793-1824 in der Werkstatt der evangelischen Schwesterngemeinschaft Herrnhut) benannten Herrnhuter Papiere mit vielfältigen geometrischen Mustern.
Kollation, Kollationieren
(lat. "vergleichen"). Das Überprüfen eines Buchs auf Vollständigkeit.
Kolophon
(griech. "das Letzte, das Ende"). Vor dem Aufkommen des Titelblatts wurden die Angaben von Titel, Ort und Zeit des Erscheinens sowie der Name des Druckers am Schluss des Buches im Kolophon zusammengefasst. Gelegentlich auch als Explicit bezeichnet, da es mit diesem Wort vielfach eingeleitet wird.
Kolorit
Im Gegensatz zum maschinellen Farbdruck die mit der Hand aufgebrachte Bemalung von Illustrationen und Karten. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts bis auf wenige Ausnahmen die einzige Möglichkeit, farbige Darstellungen zu erzeugen. Je nach Zielsetzung von sehr unterschiedlicher Qualität: Bei Tafelwerken gibt es Exemplare, die durch die Verwendung edler Stoffe besonders prächtig gestaltet wurden (z.B. durch Gold: goldgehöht). Da dies häufig den Exemplaren für Fürstenhäuser vorbehalten waren, spricht man auch von Fürstenkolorit. Im Gegensatz dazu wurde für die billige Volksgraphik (Bilderbogen etc.) früh eine starke Vereinfachung mittels Patronen bzw. Schablonen entwickelt, die heute wegen ihres besonderen graphischen Reizes gleichfalls sehr begehrt ist.
Kolumne
(lat. "Säule"). Fachausdruck der Buchherstellung für den zur Seite gestalteten Satz eines Druckwerks. Im antiquarischen Gebrauch fast nur als Bezeichnung für die Spalte im mehrspaltigen Satz.
Kolumnentitel
Die Überschriften (Kopfzeilen) der einzelnen Seiten eines Buches heißen Kolumnentitel. Sie können nur die Seitenzahlen (toter Kolumnentitel) oder aber Angaben über Kapitel, Seiteninhalt etc. (lebender Kolumnentitel) enthalten.
Konkordanz
(lat. "Übereinstimmung"). Zusammenstellung aller in einem Schriftstück oder dem Werk eines Autors vorkommenden Wörter oder Wendungen in alphabetischer Folge mit Angabe der Belegstellen, z.B. Bibelkonkordanz, Shakespeare-Konkordanz etc.
Konvolut
(lat. "das Zusammengerollte"). Antiquarische Bücher und Schriften, die nicht einzeln, sondern nur zusammen mit einem Gesamtverkaufspreis abgegeben werden, nennt man Konvolut. Im Bibliotheks- oder Archivgebrauch bezeichnet Konvolut eine Sammlung von Schriften, die nicht einzeln in den Bestandskatalog aufgenommen sind.
Kopf
Im Zusammenhang mit Bucheinbänden das obere Ende eines Buchrückens; das untere Ende heißt Schwanz.
Kopfschnitt
Der Schnitt an der oberen Kante des Buchblocks. Dieser wird vielfach gefärbt (Farbschnitt) oder bei wertvolleren Büchern als (Kopf-) Goldschnitt angelegt.
Kopfvignette
Eine Vignette, die am Anfang eines Textes oben auf der Buchseite steht, beispielsweise als Zierstück am Kapitelanfang.
Krayonmanier, Crayonmanier, Kreidemanier
Eine Technik des Kupferstichs bzw. der Radierung, mit der man die Wirkung einer Kreidezeichnung erzielt. Der Ätzgrund wird mit Hilfe einer Nadel mit mehreren Spitzen oder mittels eines mit vielen Spitzen versehenen Rädchens, des so genannten Roulettes, aufgerissen.
Kreidelithographie
Bei der Kreidelithographie wird die Zeichnung im Gegensatz zur Federlithographie auf dem Lithographiestein mit Kreide ausgeführt. Die Steinoberfläche muss dafür leicht körnig sein, was durch Verreiben von Sand erreicht wird. Der entstehende Strich ist deshalb nie völlig glatt und gleichmäßig schwarz, sondern weist eine Kornstruktur und unregelmäßige Ränder auf. Die Kreidelithographie ermöglicht sehr ausdrucksvolle Graphiken.
Kupferstich
Ein originalgraphisches Druckverfahren, bei dem der Künstler bzw. der Kupferstecher einen Entwurf auf eine Kupferplatte aufzeichnet und dann mit dem Stichel oder Grabstichel die Linien als Vertiefungen herausarbeitet. Nach dem Einfärben der Platte mit einem Ballen wird die Oberfläche wieder abgewischt, so dass die Farbe nur in der vertieften Zeichnung stehen bleibt. Der Kupferstich ist demnach ein Tiefdruckverfahren. Auf die vorbereitete Druckplatte werden angefeuchtetes Papier und eine Filzdecke gelegt. Dann wird die Platte in eine aus zwei Walzen bestehende Presse geschoben, die einen sehr starken Druck ausübt. Die Farbe hebt sich aus den Linien heraus und bleibt leicht erhaben auf dem Papier stehen. Die Kupferplatte drückt sich so stark in das feuchte Papier, dass hinterher meist ein so genannter Plattenrand erkennbar bleibt. Die Grabsticheltechnik lässt nur eine strenge Linienführung zu, weshalb für beschwingtere Darstellungen die Radierung vorgezogen wird. Da der Kupferstich über lange Zeit das einzige Verfahren war, um feine Illustrationen in Bücher zu bringen, sind die Bezeichnungen "Stich" oder "Kupfer" als Synonyme für "Abbildung" auch nach der Erfindung anderer Illustrationstechniken gelegentlich noch auf den Buchtiteln zu finden.
Kupfertiefdruck
Vgl. Tiefdruck.
Kursive
(lat. currere = "laufen"). Als Kursivschrift bezeichnet man alle schräg gestellten Schriftformen. Die Kursivtypen sind zwar im Charakter der Antiqua angepasst - sie werden zu fast jeder Antiquaschrift hergestellt -, zeigen aber im Einzelnen vielfach abweichende Formen, die auf die engere Verwandtschaft der Kursive zur Handschrift hinweist. Im englischen und französischen Sprachgebrauch heißt die Kursive "Italic" bzw. "Italique", wohl weil der italienische Drucker Aldus Manutius d. Ä. (1449-1515) der erste war, der Kursivtypen verwendete.
Kustode
(lat. custos = "Wächter") nennt man die bei älteren Drucken in der rechten unteren Ecke der Seite angebrachte Angabe des Anfangsworts der Folgeseite. Sie erleichtert dem Leser den Übergang zur nächsten Seite und bekundet, dass die Reihenfolge der Seiten, Blätter und Lagen richtig ist. Die Kustode gehört also wie die Bogensignatur, die Blatt- oder Seitenzahl zu den Ordnungshilfen des alten Buches. In den Handschriften des Mittelalters bedeutet Kustode die Bezeichnung der Lagen durch Zahlen oder Buchstaben. Das wiederholte bzw. vorweggenommene Anfangswort der Folgeseite heißt hier Reklamante.
→ nach obenLage
Bezeichnung für die zusammengehefteten, aus einem Druckbogen entstandenen Blätter eines Buches. Wird ein Druckbogen dreimal gefalzt, entsteht eine Lage aus 8 Blatt (= 16 Seiten). Vgl. Formate.
Längstitel
Form des Rückentitels, wenn dieser bei schmalen Buchrücken entlang dem Rücken ausgerichtet ist.
Läsur
Zwar in keinem Wörterbuch zu finden, im Antiquariatshandel dennoch seit langer Zeit gebräuchliche Bezeichnung für eine geringfügige Beschädigung.
Laufrichtung
Begriff aus der Papierkunde. Sind die Fasern überwiegend längs ausgerichtet, spricht man von Schmalbahnpapier, verlaufen die Fasern quer, handelt es sich um Breitbahn. Im Buch sollte das Papier stets so verarbeitet sein, dass die Hauptfaserrichtung parallel zum Rücken verläuft. Das verhindert eine Wellung des Rückens. Außerdem lässt sich das Buch so leichter blättern.
Lederschnitt
Eine selten angewandte Verzierungsform bei Ganzlederbänden. Mit dem Messer wird die Zeichnung in das aufgeweichte Leder eingeschnitten und dann durch Nachziehen mit einem stumpfen Instrument erweitert. Die eigentliche Zeit der Lederschnittbände beginnt im 14. Jahrhundert und endet im 15. Jahrhundert. Es sind nur etwas über 200 derartige Bände bekannt.
Legende
(lat. "das zu Lesende"). Im antiquarischen Gebrauch ist damit zumeist die Bildlegende gemeint: die Erklärung eines Bildinhalts, die häufig unter der Abbildung oder in einer Kartusche zu finden ist. Die Verbindung zu den Bildelementen wird durch übereinstimmende Buchstaben oder Ziffernbezeichnungen hergestellt.
Leimschattig
Wenn der vom Buchbinder verwendete Leim im Laufe der Zeit nachdunkelt und an den Klebestellen sichtbar wird (durchscheint), wird dies als leimschattig bezeichnet.
Leporello
Ein Leporello-Album ist ein Faltbuch, das durch Zick-Zack-Faltung eines oder mehrerer aneinander geklebter Stücke Papier entsteht. Beliebt war die Leporelloform bei Souveniralben mit einer Reihe von Einzelansichten und bei Panoramen. Der Name knüpft an die Figur des Leporello in Mozarts Oper Don Juan an, der das Album der Geliebten Don Juans aufzubewahren hatte.
Lichtdruck (Phototypie, Collotypie)
Ein Flachdruckverfahren (nicht identisch mit Heliogravüre!), das ausschließlich der Wiedergabe von Abbildungen dient. Die durch Lichtdruck hergestellten Reproduktionen von Photographien, Aquarellen und Gemälden sind an Originaltreue von keinem anderen Druckverfahren zu erreichen. Das Verfahren beruht auf der Fähigkeit der Chromgelatine, unter Lichteinwirkung die Quellfähigkeit zu verlieren und einen Gerbprozess zu durchlaufen. 1855 hatte Poitevin nach diesem Prinzip und mit Kohlestaub so genannte Pigmentbilder hergestellt. Tessié du Motay entdeckte 1867, dass die belichtete Chromgelatine auch fette Druckfarbe annehmen konnte und entwickelte den Lichtdruck, doch erst Joseph Albert in München machte das Verfahren praxistauglich. Man findet deshalb auch gelegentlich die Bezeichnung "Albertotypie". Als Druckform dient eine Glasplatte, auf welche die lichtempfindliche Schicht aufgetragen wird. Während des Trocknungsvorgangs beim Aufbringen der lichtempfindlichen Schicht entsteht eine sehr feine Körnung, das so genannte Runzelkorn, das später beim Druck von Bedeutung ist. Die Körnung ist so fein, dass sie mit bloßem Auge in der Regel nicht bemerkt wird. Ein Lichtdruck hat deshalb ein Aussehen, das einem Fotoabzug nahe kommt. Der Druck beruht auf dem gleichen Prinzip wie die Lithographie. Die Druckschicht ist überaus empfindlich. Mit einer Platte ist bestenfalls eine Auflage von 1500 zu erzielen. Da die Herstellung der Druckform aber nicht teuer ist, wurde das Verfahren für Kleinauflagen von Bildtafeln, Katalogen, Ansichtskarten, Urkunden und Handschriftenfaksimiles genutzt. Reine Strichvorlagen, Druckschriften usw. können im Lichtdruck nicht befriedigend wiedergegeben werden, deshalb werden sie üblicherweise in einem zweiten Druckgang in einer anderen Technik hinzugefügt.
Limitierte Ausgabe
Eine Ausgabe, bei der die Anzahl der hergestellten Exemplare klein und von vornherein begrenzt ist. Oft werden Liebhaberausgaben, Luxusdrucke, Privatdrucke als limitierte Ausgaben angefertigt, um einen erhöhten Seltenheitswert zu erreichen.
Lithographie
(griech. "Steinzeichnung, Steindruck"). Ein Flachdruckverfahren, das verschiedene Vorzüge aufweist und das Drucken von Abbildungen revolutionierte. Es beruht auf der Unvermischbarkeit von Wasser und Fett. In der einfachsten und direktesten Form wird auf einen polierten Stein, am besten eignen sich bestimmte Kalkschieferarten, die Zeichnung mit einer fettigen Kreide oder Tusche aufgebracht. Dann wird die Oberfläche des Steins mit Wasser getränkt, worauf sie nur noch an den gezeichneten (fettigen) Stellen Farbe annimmt. Beim Abdruck werden dann nur diese auf Papier reproduziert. Große Stellen, die weiß bleiben sollen, werden angeätzt und gummiert. Die neue Technik, 1796 von Alois Senefelder erfunden, wurde von den Künstlern rasch bevorzugt, da sich auf dem hellen Stein leicht zeichnen lässt und das Ergebnis zudem sehr gut zu beurteilen ist. Die Lithographie ermöglicht einen sehr viel besseren Eindruck des zu erwartenden Ergebnisses als alle anderen originalgraphischen Drucktechniken. Sie ist von allen Techniken die "handschriftlichste", da man sie mit ebenso viel Leichtigkeit handhaben kann wie das Schreiben mit der Feder, das Zeichnen mit dem Tuschpinsel oder mit Kreide auf Zeichenpapier. Verlangt ist kein angestrengtes Arbeiten mit handwerklichem Gerät, wie beim Holzschnitt oder Kupferstich. Schon Senefelder war sehr experimentierfreudig und veröffentlichte in seinen Musterblättern in verschiedenen lithographischen Kunstmanieren Druckbeispiele, die eine breite Palette technischer Möglichkeiten abdecken. Einen klaren Vorteil bot die Lithographie in der Krayonmanier. Sollte diese Technik im Kupferstich nachgeahmt werden, musste man die Struktur eines Kreidestrichs sehr aufwendig Punkt für Punkt nachempfinden. Bei der Lithographie hingegen zeichnete man auf eine leicht gekörnte Oberfläche und erzielte sofort ein perfektes Ergebnis. Frühzeitig wurde eine Vielzahl weiterer Techniken ausprobiert, auch Hoch- und Tiefdruckverfahren vom Stein, von denen aber nur die Steingravur praktische Bedeutung erlangte. Bei der Steingravur wird die Zeichnung (wie beim Kupferstich) mit dem Grabstichel in den Stein geschnitten. Von diesem Stein konnte man nun andere Lithosteine bedrucken, die dann erst für den Druck auf Papier verwendet wurden. So erzielte man höhere Auflagen und hatte zudem den Vorteil, seitenrichtig arbeiten zu können. Die Möglichkeiten, eine Zeichnung auf den Stein zu übertragen, sind ebenfalls vielfältig: vom Umdruck (der als Autographie u.a. für die Vervielfältigung behördlicher Akten genutzt wurde) bis zur Photolithographie. Das Umdruckverfahren (über zwei Zwischenschritte) erleichterte auch das Aufbringen der Schrift auf die Lithosteine, hatte Vorteile bei der Herstellung von Notenblättern oder der Rettung (durch Übertragung) eines durch einen Sprung zerstörten Lithosteins. Ja, es war sogar möglich, Kupferstiche auf Umdruckpapier abzuziehen, um sie dann als lithographisches Faksimile zu drucken. Bei der Suche nach Ersatzmaterialien für den Stein stieß man auf Zink. Darauf lässt sich ebenso wie auf Lithosteinen arbeiten (im Unterschied zum Offsetdruck also auch seitenverkehrt). Der Zinkdruck bringt jedoch schlechtere (etwas flaue, unscharfe) Ergebnisse. Der Offsetdruck ist gleichfalls ein Flachdruckverfahren und entwickelte sich aus der Lithographie. Charakteristisch ist dabei, dass der Druck nicht direkt auf Papier, sondern in einem Zwischenschritt zunächst auf ein Gummituch erfolgt. Wird der Offsetdruck als originalgraphisches Verfahren eingesetzt (und der Künstler arbeitet direkt auf der Offsetplatte), nennt man die so entstandenen Graphiken Offsetlithographie.
Livres d'heures
Französische Bezeichnung für Stundenbücher. Kommt vielfach in Buchtiteln vor. Auch kurz "Heures" genannt.
Lizenzausgabe
Die Lizenz (lat. "Erlaubnis") bleibt stets auf eine bestimmte Anzahl von Exemplaren beschränkt. In Betracht kommen Ausgaben in Buchgemeinschaften, sonstige Sonderausgaben (z.B. in Schriftenreihen) und Fälle, in denen der Originalverleger zeitweise verhindert ist, seine Tätigkeit auszuüben. Lizenzausgaben sind selten von sammlerischem Interesse.
Lumbeck-Verfahren
Ein von dem Bibliophilen Emil Lumbeck vervollkommnetes Verfahren der Klebebindung. Die verwendete Kunstharzemulsion ist allerdings nicht sehr alterungsbeständig.
→ nach obenMajuskel
(lat.). Ein so genannter "großer" Buchstabe, der auch als Versalie bezeichnet wird. Im Gegensatz zu den Minuskeln, den Kleinbuchstaben, gibt es bei den Majuskeln keine Ober- und Unterlängen. Ein in Majuskeln gesetzter Text ergibt daher ein sehr einheitliches, geschlossenes Schriftbild. Die ältesten Schriften waren durchweg Majuskel-Schriften.
Makulatur
(lat. macula = "Fleck") nennt man im Buchdruck jeden unbrauchbaren Falschdruck und alle Bogen, die bei der Vorbereitung zum Druck verdorben werden. Ferner wird so jeder bedruckte Bogen genannt, der nicht mehr seiner eigentlichen Bestimmung dient. Makulieren bezeichnet im Verlagsgebrauch die Vernichtung der Vorräte eines Druckwerks oder deren Verkauf lediglich zum Papierwert.
Manuldruck
Eine Nachdrucktechnik, die zu den photographischen Übertragungsverfahren gehört. Manuldrucke wirken meist etwas unscharf. Vom nachzudruckenden Werk wird ein Negativ im Reflexkopierverfahren genommen und dann auf Offset- oder Zinkdruckplatten übertragen. Die Bezeichnung Manuldruck ist ein Anagramm aus dem Namen des Erfinders Max Ullmann.
Marginalien
(neulat.). Randbemerkungen am äußeren Rand der einzelnen Buchseiten. Gedruckte Marginalien sollen in der Art der Kolumnentitel Hinweise auf den Inhalt von Textstellen, Absätzen oder Seiten geben, vor allem bei wissenschaftlichen Werken. Im antiquarischen Gebrauch auch allgemein für handschriftliche Anmerkungen im Buch.
Marmorpapier
(auch: Tunkpapier, Türkisch Papier, "Ebru"), Marmorschnitt, Marmorieren. Das Marmorieren ist eine besondere Form der Buntpapierherstellung. Marmorpapiere wurden als Bezugspapier von Buchdeckeln, aber auch sehr häufig als Vorsatz verwendet. Sie tauchen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus der Türkei kommend in Deutschland auf. Die Technik unterscheidet sich grundsätzlich von allen anderen Herstellungsarten des Buntpapiers, da der Farbauftrag und das Muster zunächst auf dem Schleimgrund erzeugt und dann nur vorsichtig mit einem angefeuchtetem Papierbogen "abgehoben" werden. Der Schleimgrund wurde zunächst nur aus Tragant bereitet, ein pflanzlicher Stoff, der in Wasser stark quillt und einen zähen Schleim ergibt, dann zunehmend, da preiswerter und leichter verfügbar, aus Carraghen-Moos, einer Tangart. Auf diesen Grund werden die Farben schwimmend in Tröpfchen- oder Streifenform aufgetragen. Die Fließeigenschaft der Farben wird meist durch Zugabe von Ochsen- oder Fischgalle so verändert, dass sie sich nicht vermischen, sondern durch Ausbreitung und Verdrängung zufällige, nur in gewissem Rahmen beeinflussbare Muster entstehen. Geschickte Marmorierer konnten ihren Mustern das Aussehen von Blumen (z.B. Tulpenmuster) geben oder gar regelrechte Bilder erzeugen. Je nach entstandenem Muster gibt es differenzierte Bezeichnungen für das marmorierte Papier: Kamm-Marmor, Schneckenmarmor, Granit-Marmor (kleine "blasenartige" Muster), Achatmarmor (großflächigere "blasenartige" Muster). Wolkenmarmor und Gustav-Marmor werden anders hergestellt (siehe unter Spritzpapier). Die Marmoriertechnik eignet sich auch zum Verzieren anderer Oberflächen; häufig ist etwa ein marmorierter Buchschnitt zu finden.
Maroquin
Eine kostbare Ledersorte für Bucheinbände, die ursprünglich ausschließlich von marokkanischen Ziegen stammte, heute aber überwiegend aus anderen Regionen kommt. Es zeichnet sich durch eine starke Narbung aus. Auf Grund eines besonderen Gerbverfahrens lässt es sich gut mit Pflanzenfarben behandeln, wobei man satte Farben erzielt.
Metallpapier
Eine Art des Buntpapiers bei der Metall nicht als Muster, sondern großflächig aufgetragen wurde. Auf einen Leim- oder Kleisterfarbgrund, sehr beliebt waren Grün oder ein Orangeton, dem zur verbesserten Haftung eventuell noch Eiweiß beigemischt war, wurde Blattmetall (Messing = Gold, Zinn = Silber) aufgelegt und mit der Walzenpresse angedrückt. Bei Broschürenumschlägen aus solchen Papieren findet man oft erhabene (von der Rückseite her ausgeführte) Titelprägungen.
Metallschnitt
Der Metallschnitt ist in seiner Herstellung dem Holzschnitt sehr ähnlich, nur wird, statt des Holzes, eine dünne Metallplatte (Messing, Blei, Kupfer) verwendet. Seine Blütezeit hatte der Metallschnitt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die Hersteller waren hauptsächlich Goldschmiede. Metall lässt sich leichter verarbeiten als Holz, da es keine Faserung besitzt. Außerdem können mit Punzen (siehe dort) Muster (Kreise, Karos, Wappenlilien usw.) eingeschlagen werden. Eine Weiterentwicklung des Metallschnitts ist der Schrotschnitt.
Mezzotinto
(ital.). Bezeichnung für das Schabkunstverfahren, bei dem auf einer Kupfer- oder Stahlplatte durch mechanisches Aufrauen, also ohne Ätzen, ein dunkler Druckgrund geschaffen wird. In der Kunstgeschichte auch als Bezeichnung für die Mittel- und Halbtöne einer Zeichnung oder Malerei gebräuchlich.
Miniatur
Ursprünglich nur die Kapitelüberschriften und Initialen in Handschriften, die mit roter Mennigfarbe ("minium") ausgeführt wurden. Im Laufe der Zeit wurde der Begriff allgemein auf den ganzen Schmuck des Buches ausgedehnt und bezieht sich heute im antiquarischen Gebrauch überwiegend auf den Bildschmuck der Handschriften. Als mit der Erfindung des Buchdruck neue Techniken die Miniatur verdrängten, begannen die Buchmaler, ihre Bildchen als Einzelblätter zu vertreiben oder sie zur Verzierung kleiner Gebrauchsgegenstände zu verwenden. Das kleine Format dieser Arbeiten, zusammen mit der falschen Assoziation des Wortes, bewirkte, dass man seit dem 16. Jahrhundert allgemein ein kleines Bild darunter versteht.
Minuskel
(lat.). Ein so genannter "kleiner" Buchstabe, der auch als Gemeine bezeichnet wird. Auch als Kurzbezeichnung für "karolingische Minuskel" üblich, einer unter Karl dem Großen entstandenen und bis in 14. Jahrhundert weit verbreiteten Schrift, nach deren Vorbild die Gemeinen unserer heutigen Antiqua gestaltet wurden.
Monographie
(griech. "Alleinschrift"). Eine Einzelpublikation, in der ein bestimmtes, genau umgrenztes Thema behandelt wird. Das Wort hat sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts eingebürgert.
Mumiendruck
Ein Druckwerk auf künstlich alt gemachtem Papier, bei dem sogar der Eindruck von Moderschäden erzeugt wird.
Musenalmanach
Bezeichnung für eine besondere Art des Almanachs. Der bibliophil ausgestattete Musenalmanach nimmt nur literarische Beiträge auf. Zunächst waren das vielfach noch unveröffentlichte Balladen, Lieder, Romanzen, Fabeln, Gelegenheitsgedichte, Epigramme. Im Laufe der Zeit kamen dramatische Szenen, Proben aus Dramen, manchmal auch Vertonungen von Gedichten hinzu. Außerdem ist ein Kalendarium beigegeben, das oft mit Kupfern zu jedem Monat geschmückt ist, ferner Vignetten, Porträts besonders verehrter Dichter.
Musterband
Ein Probeband, den der Buchbinder vor Beginn einer größeren Bindearbeit als Muster anfertigt. Es ist jedoch auch das Muster darunter zu verstehen, das der Verlagsvertreter oder der Reisende des Reisebuchhandels zum Vorlegen beim Kunden mit sich führt. Von großen Reihenwerken und mehrbändigen Lexika gibt es solche Musterbände, die gelegentlich im Antiquariatshandel angeboten werden. Der Musterband enthält, anders als der reine buchbinderische Probeband, weitere Beispiele (Farbtafeln, Karten, Probeseiten).
→ nach obenNachdruck
Zunächst steht Nachdruck für den unveränderten Wiederabdruck eines Werkes, wobei je nach gewähltem Verfahren zumeist eine spezielle Bezeichnung vorgezogen wird, z. B. Stereotypie oder Manuldruck. Heute spricht man bei der Vielzahl der technisch möglichen Nachdrucke überwiegend von Reprint. Vor allem aber bezeichnet Nachdruck den unrechtmäßigen Abdruck einer Originalausgabe durch einen anderen als den rechtmäßigen Verleger oder Lizenznehmer. Die Nachdrucker konnten Bücher erheblich billiger auf den Markt bringen, da sie keine Honorare zahlten. Vielfach wurden die Texte gekürzt und entstellt, worunter das Ansehen des Autors litt. Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts begann man, das Buch als geistiges Eigentum des Autors anzusehen und dessen Schutz auch ohne Privileg zu fordern. Einen ersten Höhepunkt der Nachdrucke gab es während der Reformation. Mit dem Aufblühen der deutschen Literatur in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam es zu einer erneuten Flut von Nachdrucken. Erste wirksame Gesetze gegen den Nachdruck wurden zwischen 1830 und 1835 erlassen. Mit dem Urheberrechtsgesetz Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann endgültig eine Rechtsverbindlichkeit erreicht. Dessen ungeachtet, gab es weiterhin Nachdrucke. In der sozialistischen Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg oder aus der Protesthaltung der Achtundsechziger heraus setzte man sich bewusst über die Verbote hinweg und veranstaltete von Werken, die man als teuer, elitär oder auch nur mühsam zu beschaffen erachtete, so genannte Raubdrucke.
Narbe, (bzw. der Narben)
Im Buchbindergewerbe die natürliche oder künstlich hergestellt Struktur einer Lederoberfläche.
Naturselbstdruck
Die Herstellung von Abdrucken unmittelbar nach den Naturgegenständen. Der Naturselbstdruck ermöglicht sehr naturgetreue Bildwiedergaben. Die einfachste Form fand schon Anfang des 15. Jahrhunderts Verwendung, als man flach gepresste Pflanzenblätter mit Farbe oder Graphit einfärbte und auf Papier druckte. Um 1830 kam ein Verfahren auf, bei dem die Pflanzen zunächst in Bleiplatten gepresst und die Bleiplatten dann als Druckform verwendet wurden. 1850 wurde diese Methode durch die Erfindung eines galvanischen Verfahrens (Metallbeschichtung auf elektrolytischem Weg) verbessert. Aus der galvanisch erzeugten Hochplatte entsteht durch nochmalige Galvanisation die druckfähige Kupfertiefdruckplatte. Mit diversen Verfahren können alle flachen Naturgegenstände, auch Gewebe, Spitzen u.ä., vervielfältigt werden.
Nekrolog
Nachruf, (kurze) Lebensbeschreibung eines Verstorbenen bzw. die Zusammenstellung mehrerer solcher Biographien.
Nonpareille
(franz. "unvergleichlich"). Schriftgrad von 6 Punkt Kegelstärke. Die Bezeichnung soll wohl eine Anerkennung für den Schriftgießer ausdrücken, der eine solch kleine Schrift herstellen kann. Nonpareille steht im übertragenen Sinn auch für "das Kleingedruckte".
Norm
Auf der ersten Seite eines Druckbogens findet man zusammen mit der Bogensignatur häufig in sehr kleiner Schrift eine Kurzform des Titels, zuweilen ergänzt durch den Autorennamen und bei mehrbändigen Werken durch die Bandbezeichnung. Die Norm soll Buchdrucker und Buchbinder anzeigen, zu welchem Werk der Bogen gehört.
Notation
(lat. "Bezeichnung, Bemerkung"). Im Allgemeinen als Bezeichnung für Notenschriftensysteme in der Musik gebraucht, aber auch für die Darstellung wissenschaftlicher Formeln, die Aufzeichnung von Zügen einer Schachpartie, Tanzschritte etc.
→ nach obenOasenziegenleder
Ein aus den Häuten zentralafrikanischer Ziegen hergestelltes Leder, das besonders haltbar ist und gern für Bucheinbände verwendet wurde. Dem Oasenziegenleder ähnlich, jedoch aus größeren Häuten hergestellt und nicht zwingend aus Afrika stammend ist das Karawanenziegenleder.
Oblaten
(auch Glanzbilder, Poesiebilder, Stammbuchbilder, Vielliebchen genannt) sind ausgestanzte Bildchen, wie sie zum Verzieren von Kuchen und Torten, als Andenkenbilder und sehr häufig in Stammbüchern und Poesiealben benutzt wurden. Anfangs handkoloriert, wurden sie seit 1880 hauptsächlich in Chromolithographie und mit Reliefprägung gefertigt.
Oblong
Länglich. Wird manchmal im Sinne von "schmal" verwendet (8° oblong).
Offizin
Werkstätte, insbesondere die Druckerwerkstätte.
Offset
Ein indirektes Flachdruckverfahren, bei dem nicht unmittelbar von der Druckform auf das Papier gedruckt, sondern der Druck zunächst auf eine mit einem Gummituch bespannte Walze und erst von dort auf das Papier übertragen wird. Das Auftragen des Druckbilds, das wegen der Zwischenstufe über das Gummituch seitenrichtig auf der Druckform stehen muss, kann wie bei der Lithographie von Hand erfolgen und wird dann gerne als Offsetlithographie bezeichnet. Der Offsetdruck, der Anfang des 20. Jahrhunderts aufkam, ist heute die am häufigsten angewandte Drucktechnik. Für den allgemeinen Gebrauch wird die Druckform mit fotografischen Verfahren hergestellt.
Oktav
(lat. octo = "acht"). Formatbezeichnung. Wird ein Druckbogen dreimal gefalzt, so dass daraus 8 Blatt entstehen, nennt man das Format eines daraus bestehenden Buchs Oktav(o). Bei literarischen Werken war und ist das Oktavformat besonders beliebt. Es wird deshalb als Standard angesehen und in antiquarischen Buchbeschreibungen im Gegensatz zu allen abweichenden Formaten normalerweise nicht erwähnt.
Originaleinband
Der Originaleinband im Sinne eines Verlagseinbands kam erst im 19. Jahrhundert auf. Zwar gab es schon früher gelegentlich Werke, die in weitgehend einheitlichen Einbänden ausgeliefert wurden, doch erst mit Beginn der maschinellen Massenproduktion wurde der Verlagseinband üblich, wobei man durchaus Werke in 2 bis 3 unterschiedlich qualitätsvollen Einbänden zu unterschiedlichen Preisen anbot.
Originalumschlag
Eine leichtere Form des Originaleinbands (nicht zu verwechseln mit dem Schutzumschlag). Diese für broschierte Bücher, Einzelhefte von Lieferungswerken oder auch Zeitschriften vom Verlag gewählte Einbandart kann auch Mitteilungen enthalten, die sonst im Buch nicht zu finden sind. Werden solche Werke später mit einem festen Einband versehen, ist es unter bibliophilen Gesichtspunkten vorzuziehen, dass der Originalumschlag mit eingebunden wird.
→ nach obenPaginierung, Pagination, Pagina, Paginieren
Seitenzahl bzw. die einzelnen Seiten oder Kolumnen mit Seitenzahlen (Pagina) versehen. Werden nicht die Seiten, sondern nur die Blätter gezählt, spricht man von Foliierung. Bei ein- oder zweibändigen Werken wird die Pagination in der korrekten antiquarischen Buchbeschreibung angegeben (z.B. in der Form 4 Bl., LV, 212 S., 2 Bl. = 4 nicht nummerierte Blatt, 55 römisch nummerierte Seiten, 212 arabisch nummerierte Seiten, 2 nicht nummerierte Blatt); ist die erste angegebene Seitenzahl größer als 1, so wird die Pagination auf die davorliegenden Seiten zurückgerechnet. Man bezieht diese also mit ein, während am Schluss die letzte ausgedruckte Seitenzahl maßgebend ist.
Palimpsest
(griech.) heißt ein nach dem Entfernen einer ersten Schrift erneut beschriebenes Schriftstück. Palimpseste entstanden überwiegend, weil man das kostbare Schreibmaterial (Papyrus, Pergament) wiederverwenden wollte.
Pamphlet
Eine Druckschrift kleineren Umfangs, meist eine politische Flugschrift, eine Streit- oder Schmähschrift. Im Englischen wird jedes kleine Werk bis zu 5 Bogen Umfang ohne Berücksichtigung des Inhalts als "pamphlet" bezeichnet.
Papierbräunung
Je nach Inhaltsstoffen bzw. Herstellungsmethode sind Papiere unterschiedlich stark anfällig für Bräunung. Ein wesentlicher Faktor für den Vergilbungsprozesses unter Lichteinwirkung (entscheidend ist der UV-Anteil, Kunstlicht ist weitgehend unproblematisch), sind Holzanteil und Säuregehalt. Papiere die vor ca. 1850 im traditionellen Schöpfverfahren hergestellt wurden, enthalten normalerweise kein Holz und sind deshalb relativ unempfindlich. Durch andere Prozesse kann es in seltenen Fällen aber auch hier zu starker Bräunung kommen. Problematisch ist Bräunung, Brüchigwerden und Zerfall des Papiers bei gewissen Maschinenpapieren wie sie seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hergestellt werden. Für die maschinelle Produktion ist die Zugabe von Aluminiumsulfat nötig, aus dem sich im Lauf der Zeit Schwefelsäure bildet. Sie zerstört die Zellulose und beeinträchtigt deshalb stark die Festigkeit.
Papierfehler
Sowohl bei maschinell gefertigtem als auch beim handgeschöpften Papier können Papierfehler entstehen. Meist handelt es sich um Löcher (Stellen, an denen der Papierbrei zu dünn war) oder um Verdickungen und Verfärbungen (Stellen, an denen ein Fremdkörper in das Papier geraten ist). Wenn solch ein Fehler nicht erkannt und das Papier trotzdem bedruckt wird, kommt es zu weiteren Fehlern (z.B. weiße Stellen im Druck oder starkes Durchscheinen).
Pappband
Ein Buch, dessen Einband aus festen, mehr oder weniger steifen Pappen besteht. Pappe nennt man Kartonsorten mit Quadratmetergewichten ab ca. 550 Gramm. Dickere Pappen bestehen oft aus mehreren Schichten oder Lagen. Der Einband aus Pappe ist mit Buntpapier oder bedrucktem Papier überzogen bzw. überklebt (kaschiert). Pappe wird keineswegs nur wegen der geringeren Materialkosten verwendet, die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten machen den Pappband als Einband attraktiv.
Patrone
Soviel wie Schablone.
Pergament
Aus enthaarten, geglätteten und getrockneten Tierhäuten (Schaf-, Ziegen-, Kalbfelle) hergestellter zäher, schmiegsamer Schriftträger. Bei trockener Lagerung ist es außerordentlich haltbar. Im Unterschied zu Leder entsteht Pergament nicht durch Gerbung. Pergament hat eine "Haarseite" mit einer etwas raueren Oberfläche und eine glatte (bzw. geglättete) "Fleischseite". Bereits die Ägypter kannten Pergament, die ältesten Funde stammen aus der Zeit um 2700 v.Chr., es spielte aber keine große Rolle. Der Name leitet sich von der kleinasiatischen Stadt Pergamon ab, es gibt aber keine Anzeichen dafür, dass Pergamon je eine herausragende Rolle in der Herstellung oder im Handel mit Pergament gespielt hätte. Viele mittelalterliche Handschriften sind auf Pergament geschrieben, doch ging man schon im Mittelalter zu Papier über. Trotzdem verwendeten auch die ersten Buchdrucker Pergament gerne für stark genutzte Druckwerke, und auch später noch gab es immer wieder Prunkdrucke auf Pergament. Etwas stärkere Sorten verwendete man für Einbände, darunter auch Schweinspergament (zum Beschreiben wird dies nicht genutzt). Pergamenteinbände haben eine glatte, narbenlose Oberfläche von weißer bis gelblicher Farbe, die sich wie Horn oder Elfenbein anfühlt.
Pergamentpapier
Ein zähes, meist etwas durchscheinendes, durch Säure- und Ammoniakbäder verändertes Papier. Widerstandsfähiger als das Ausgangsmaterial.
Pergamin
(auch Pergamyn). Ein Papier, das durch spezielle Behandlung fast den Charakter von Pergament annimmt. Damit hergestellte, lichtdicht gelagerte Einbände sind oft nur schwer von Pergament zu unterscheiden. Unter Lichteinfluss ist Pergamin jedoch nicht alterungsbeständig, es vergilbt (bis zu kräftigem Braun) und wird brüchig.
Photogravüre
Gleichbedeutend mit Heliogravüre.
Photolithographie
Bezeichnung für die Herstellung der lithographischen Druckform auf photographischem Weg. Es kann die Übertragung einer Originalphotographie oder einer photographischen Reproduktion eines sonstigen Originals auf eine Druckform sein. Zahlreiche unterschiedliche Verfahren wurden dafür entwickelt.
Plagiat
(lat. plagium = "Menschenraub"). Geistiger Diebstahl. Die widerrechtliche Verwertung geistigen Eigentums, das als eigene Schöpfung ausgegeben wird. Auch ein rechtmäßiger Abdruck ohne Quellenangabe gilt als Plagiat.
Platte, Plattenrand
Die meisten Druckformen können auch als Platte bezeichnet werden. Besonders bei originalgraphischen Tiefdruckverfahren (Kupfer- und Stahlstich, Radierung, Aquatinta etc.) spricht man von der Platte. Beim Holzschnitt spricht man eher vom Stock, bei der Lithographie vom Stein. Da die Abdrucke in feuchtes Papier unter hohem Druck erfolgen, zeichnet sich die Platte oft deutlich ab, die Plattenränder sind dann als eingeprägte Form, als Plattenrand, erkennbar.
Pochoirkolorit
Vgl. Schablonen.
Portolan
Mittelalterliches Segelhandbuch. Als Bezeichnung für frühe handschriftliche Seekarten gebräuchlich.
Prägedruck
Jedes Verfahren, das mit Hilfe einer Prägeform eine erhabene oder vertiefte Abprägung erzielt. Der Prägedruck wurde immer wieder zur Verzierung von Einbänden verwendet, im 19. Jahrhundert auch für Vorsatzpapiere (vgl. gaufriertes Papier). In Bezug auf den Einband spricht man von Blindprägung.
Pressendrucke
nennt man die Drucke der kunstgewerblichen Privatpressen, im weiteren Sinne auch alle anderen mit vorwiegend buchkünstlerischer Absicht geschaffenen Druckwerke der neueren Zeit (gesamtes 20. Jahrhundert), z.B. wertvolle Privatdrucke und bibliophile Bücherreihen.
Privatdrucke
Alle nicht im Buchhandel erhältlichen, im Auftrag und auf Kosten von Privatpersonen gedruckten Schriften. Sie werden meist in kleiner Auflage und ohne kommerzielle Absicht hergestellt. Vielfach handelt es sich um politische, erotische oder familiengeschichtliche Werke, oft in bibliophiler Ausstattung. Bühnenstücke, die als Privatdrucke veröffentlicht werden, tragen den Vermerk "als Manuskript gedruckt".
Privileg
(lat. "Vorrecht, Sonderrecht"). Bis Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in Deutschland für den Verfasser eines Werks keinen urheberrechtlichen Schutz. Der Nachdruck konnte bis dahin nur durch besondere Privilegien verhindert werden. Zunächst im Sinn eines Gewerbeprivilegs wurde Druckern zugesichert, dass sich am gleichen Ort bis zu einem gewissen Zeitpunkt kein zweiter Drucker niederlassen durfte. Seit ungefähr 1490 wurden Privilegien für einzelne Bücher erteilt und damit der Nachdruck innerhalb eines bestimmten Gültigkeitsgebiets und für eine enge zeitliche Begrenzung (meist unter 10 Jahren) verboten. Kaiser, Papst, Landesherren und freie Reichsstädte konnten Privilegien erteilen. Häufig sind die Privilegienbriefe am Anfang des Buches abgedruckt. Manchmal wurden sie auch von den Druckern fingiert.
Probeband
Bei einem größeren Auftrag wird vom Buchbinder vor Beginn der Bindearbeit vielfach ein Probeband vorgelegt, der lediglich leere Papierbogen enthält. Probebände können auch für Reklamezwecke angefertigt werden, sie enthalten dann zusätzlich Druckbeispiele und werden eher als Musterband bezeichnet.
Provenienz
. Der Nachweis durch Besitzvermerk, Exlibris oder Supralibros, dass ein Buch aus einer berühmten Bibliothek stammt.
Pseudonym
(griech.). Deck- oder Scheinname. Schriften, die mit einer anderen als der richtigen Verfasserangabe versehen sind, erscheinen pseudonym. Je nach Art des gewählten Scheinnamens gibt es eine Vielzahl spezieller Bezeichnungen: Allonym, Anagramm, Aristonym etc.
Punze
Metallstift, der zum Einschlagen von Vertiefungen in Metall verwendet wird. Stempelschneider schlagen damit die freien Räume innerhalb eines Buchstabenbilds in den Schriftstempel, Goldschmiede verwenden Punzen mit verschiedenen, erhaben gearbeiteten Bildern (Blüten, Karos, Sterne, Kreise, Wappenlilien). Schon früh bedienten sich ebenfalls die Buchbinder der Punze, um plastische Ornamente auf Ledereinbänden zu erzeugen. Auch den Farbschnitt verziert man mit Hilfe von Punzen, indem man Ornamente einschlägt, die aus einzelnen gepunzten Punkten bestehen.
→ nach obenQuart
(lat. "vier"). Formatbezeichnung. Wird ein Druckbogen zweimal gefalzt, so dass daraus vier Blatt entstehen, nennt man das Format eines daraus gebundenen Buches Quartformat.
Quetschfalten
entstehen beim Druck, wenn das Papier nicht völlig plan liegt und die Druckfarbe nicht alle Stellen erreichen kann. Sie erscheinen später als weiße Aussparungen, die z.B. wie Risse aussehen.
Quodlibet
"Was beliebt." Die im 19. Jahrhundert beliebten zeichnerischen Zusammenstellungen unterschiedlicher Schriftstücke und Gegenstände (ähnlich wie Stillleben, aber in einer Ebene) werden als Quodlibet bezeichnet.
→ nach obenRadierung
(lat. radere = "schaben"). Ein originalgraphisches Verfahren ähnlich dem Kupferstich. Bei der Radierung graviert der Künstler die Zeichnung jedoch nicht direkt in die Metallplatte, sondern überzieht diese zunächst mit einem so genannten Ätzgrund (Wachs, Harz, Asphaltlack o.ä.), in den er dann mit der Radiernadel seine Zeichnung einritzt. Da dies ohne großen Kraftaufwand geschieht, können im Gegensatz zum Kupferstich Skizzen mit leichter Linienführung umgesetzt werden. Danach wird die Platte in ein Säurebad gelegt. An den durch die Nadel freigelegten Stellen greift die Säure das Metall an. Durch Abdecken einzelner Partien mit Ätzgrund und weitere Säurebäder können unterschiedlich tiefe Linien geätzt werden. Je tiefer eine Linie ist, desto mehr Farbe kann sie aufnehmen und umso kräftiger wird sie beim Druck. Vor dem Druck, der genau wie beim Kupferstich erfolgt, muss der Ätzgrund vollständig entfernt werden. Bei Radierungen ist es beliebt, einen ganz feinen Farbhauch auf der Platte stehen zu lassen, so dass auf dem Papier ein feiner Ton (der Plattenton) entsteht.
Raubdruck
Unberechtigte Nachdruckausgabe, die ohne Wissen des Verfassers und Verlegers erfolgte. Die Bezeichnung Raubdruck wurde erst üblich, nachdem durch die Urheberrechtsgesetze Ende des 19. Jahrhunderts ein rechtlich verbindlicher Schutz gegen Nachdrucke worden war.
Recto
(lat.). Die Vorderseite eines Blatts. Das Gegenteil von verso.
Regesten
(lat.). Auszüge aus Urkunden, in chronologischer Reihenfolge angeordnet. Regesten müssen so abgefasst sein, dass sich das Studium der Urkunden erübrigt.
Reglieren, Regletten
Um ein geschlossenes Schriftbild zu erzeugen, wurden in Handschriften Kolumnen häufig durch feine durchgezogene Linien eingegrenzt, mit anderen Worten: "regliert". Beim Schriftsatz nennt man die dünnen Metallleisten, die zwischen die Zeilen gestellt werden, um den Abstand voneinander (Durchschuss) zu erhöhen, "Regletten".
Reibedruck
Handdruck von Druckplatten (Holz oder Stein) ohne Verwendung einer Druckerpresse. Das Papier wurde dazu früher auf die eingefärbte Druckform aufgelegt und mit einem Lederballen oder Falzbein angedrückt bzw. angerieben.
Reihentitel
Gemeinsamer Titel einer Publikationsreihe, deren Einzeltitel in losen Abständen erscheinen und in sich selbstständig sind. Kann auf dem Titelblatt vermerkt oder als zweites eigenständiges Titelblatt beigegeben sein. Für die Werkausgabe eines Autors wird z.B. häufig der Reihentitel Gesammelte Werke gewählt, auch die Bezeichnungen von großen Reihenwerken (Märchen der Weltliteratur, Insel-Bücherei etc.) gelten als Reihentitel.
Reispapier
ist kein Papier im wörtlichen Sinne, sondern ein schneeweißes pflanzliches Material, das im ostasiatischen Raum zur Kunstblumenfabrikation und als Basis für Tusch- und Aquarellmalerei dient. Es wird furnierartig aus dem Mark von Tetrapanax papyreferum (ältere Namen: Aralia papyrifera und Aeschynomene paludosa) geschält. In China ist es etwa seit dem Jahr 300 bekannt, in Europa wird es 1690 erstmals erwähnt. Hier waren Bilder auf Reispapier besonders zwischen 1850 und 1920 beliebt. Auf Karton oder Pappe montiert, ist es gelegentlich in Alben zu finden. Wegen seiner weichen Oberfläche und der leichten Brüchigkeit ist es sehr empfindlich. Reisstrohpapier ist dagegen ein eher zähes, dauerhaftes meist leicht farbiges Papier.
Reliure
Französische Bezeichnung für Bucheinband, tritt als Fachbegriff in Verbindung mit beschreibenden Zusätzen auf (z.B. Reliure à la Cathédrale = "Einband im Kathedralstil").
Remarke
So werden kleine Skizzen, Einfälle (remarque), Bildwiederholungen genannt, die ein Künstler auf dem Plattenrand eines Kupferstichs oder einer Radierung angebracht hat, um einen besonderen Plattenzustand (état) kenntlich zu machen.
Remboîtage
nennt man das Umbinden in einen fremden Einband, um den Anschein eines Einbands der Zeit zu erwecken oder ein wertvolles Werk mit entsprechend wertvollen historischen Einbänden zu versehen. Auch das Wiedereinhängen in die alte Decke nach Auffrischungsarbeiten heißt Remboîtage.
Repertorium
(lat.). Soviel wie Nachschlagewerk.
Retusche
(franz. "Ver- oder Nachbesserung"). Im antiquarischen Sinn bezeichnet Retusche die manuelle Überarbeitung von bereits gedruckten Abbildungen, um besondere Effekte zu erzielen, die mit den zeitgenössischen Drucktechniken nicht erreichbar waren, z.B. der Farbverlauf im Faltenwurf der Kleidung, die als einfache Farbfläche gedruckt und dann per Hand retuschiert wurde. In der modernen Photographie bezeichnet Retusche die Überarbeitung von Abbildungen zur Verbesserung der Bildwirkung oder zur Beseitigung technischer Fehler und Mängel, sowohl am Negativ als auch am Positiv.
Rocaille
(franz. "Grottenwerk, Muschelwerk"). Ein besonders im Rokoko beliebtes Ornament, dessen asymmetrisches, spielerisch schwingendes Grundmotiv aus der Muschelform abgeleitet ist. Es ist namensgebend für die Stilepoche des Rokoko.
Rohbogen
nennt man Druckbogen, die aus der Druckerei kommen und vom Buchbinder noch nicht behandelt sind (ungefalzt, unbeschnitten). Früher war es üblich, einen erheblichen Teil einer Auflage in Rohbogen einzulagern und nur bei Bedarf eine neue Quote zu binden. Werden Rohbogen gefalzt und zusammengetragen, entsteht ein Rohexemplar. Es ist noch immer nicht geheftet, beschnitten oder geleimt. Für bibliophile Drucke war dies früher eine beliebte Form der Auslieferung.
Rollenstempel
(auch Rolle oder Roulette). Werkzeug des Buchbinders, bei dem das Motiv auf einem metallischen Zylinder angebracht ist und so durch Überrollen des Buchdeckels unter Druck fortlaufend eingeprägt werden konnte.
Romabütten
Sortenbezeichnung (Produktname) eines Papiers aus einer traditionellen italienischen Papiermühle. Lichtechte, farbige Handbüttenpapiere, die gerne für Vorsätze, Interimsumschläge, Überzüge usw. verwendet werden.
Rubrizieren, Rubrikator
In mittelalterlichen Handschriften und auch in Frühdrucken war es üblich, einzelne Abschnitte durch rote Einzeichnungen oder Zierbuchstaben hervorzuheben. Dies war die Tätigkeit des Rubrikators. In der einfachsten Form handelt es sich um einen senkrechten roten Strich durch den Buchstaben, in der aufwendigeren Form ist es ein größerer eingezeichneter Buchstabe. Tritt dieser Buchstabe durch seine Größe oder weitere Verzierungen hervor, wird er als Initiale bezeichnet. Der Begriff Rubrik hat hier seinen Ursprung.
Rücken
Der Teil des Buches, an dem der Buchblock bzw. die Bogen zusammengeheftet sind. Als Teil des Bucheinbands verbindet der Rücken die beiden Buchdeckel.
Rückentitel
Der Rückentitel wird auf den Buchrücken aufgeprägt oder aufgedruckt. Er ist vielfach aus Platzmangel gekürzt oder auch, bei schmalen Buchrücken, längs gedruckt (Längstitel).
→ nach obenSchabkunst
Ein originalgraphisches Verfahren, bei dem eine Metallplatte (Kupfer) mit einem Granierstahl, einem gezähnten Wiegemesser, aufgeraut wird, so dass eine gleichmäßige raue Oberfläche entsteht. Mit einem Schabeisen werden die Stellen, die im Abdruck heller erscheinen, wieder geglättet. Je glatter die Fläche, desto weniger Farbe kann sie aufnehmen. So lassen sich alle Töne vom hellsten Licht bis zum tiefsten Schatten hervorbringen. Die Technik wurde Mitte des 17. Jahrhunderts erfunden. Sie ermöglichte eine Bildwiedergabe, wie sie bis dahin mit den Mitteln der Graphik nicht zu erzielen war. Die Blütezeit der Schabkunst, auch Mezzotinto genannt, war in der zweiten Hälfte des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Es wurden sogar farbige Wiedergaben (Farbstiche) hergestellt. Die Platten waren sehr empfindlich und ließen nur geringe Auflagen (etwa 100 gute Drucke) zu. Für größere Auflagen mussten die Platten überarbeitet (aufgefrischt) werden, was einen Qualitätsverlust mit sich brachte, oder es wurden mehrere gleichartige Platten benötigt, was solche Werke natürlich teuer und exklusiv machte.
Schablonen (stencil, pattern, pochoir)
Um kleine Serien weitgehend gleichförmiger farbiger Graphiken herzustellen, benutzte man Schablonen (auch Patronen genannt). Besonders zur Kolorierung von Spielkarten, Andachtsbildern, Bilderbogen, Stickmustervorlagen oder auch für Buntpapiere und Bilderbücher erfreuten sie sich großer Beliebtheit. Die mit Schablonen erzeugten Farbflächen lassen oft einen Pinselstrich erkennen, der unabhängig von der Form der Fläche geradlinig verläuft.
Schärfen des Leders
Wird Leder an den Rändern ganz dünn geschabt, um einen eleganten Übergang zu erzielen, heißt dies Schärfen.
Schlagwort
Ordnungswort für Bibliographien, Kataloge, Lexika und Register. Das Schlagwort soll den sachlichen Inhalt des Geschriebenen auf den Punkt bringen. Im Gegensatz zum Stichwort muss es kein dem Buchtitel entnommenes Wort sein.
Schließe
Alte Einbände (16./17. Jahrhundert) werden auf der Schnittseite häufig durch Buchschließen zusammengehalten. Das verhindert ein Verwerfen der Einbanddeckel und presst den Buchblock so zusammen, dass kein Staub eindringen kann. Die Schließen bestehen häufig aus einer flachen verzierten Metallklammer, die mit einem Lederstreifen oder einem Scharnier an der Außenkante des hinteren Deckels befestigt ist, und einem in die Kante des Vorderdeckels eingelassenen kleinen Gegenstück. Sie können aufwendig verziert sein (z.B. Silberschließen mit großflächigen durchbrochenen Schlössern). Bei jüngeren Einbänden kommen Schließen fast nur noch bei Bibeln oder Gebetbüchern vor. Denselben Zweck wie die Schließen erfüllen manchmal auch einfache Schließbänder.
Schlussvignette
Eine Vignette, die als graphischer Abschluss am Ende eines Textes steht, häufig in der Form des Cul-de-lampe.
Schmutztitel
Das Blatt, das dem Titelblatt vorgeschaltet und mit einem Kurztitel versehen ist, nennt man Vortitel, seltener Schmutz- oder Vorsatztitel.
Schnitt
Die drei Seiten des Buchblocks, an denen die Bogen nicht zusammengeheftet sind. Diese sind in der Regel beschnitten, damit man das Buch öffnen kann (vgl. dagegen unbeschnitten).
Schönseite
oder Filzseite nennt man im Gegensatz zur Siebseite die glattere Seite des Papiers. Bei graphischen Papieren kann eine deutliche Unterscheidung von Schön- und Siebseite erwünscht sein, für Druckpapiere ist die so genannte Zweiseitigkeit eher unangenehm. Die beim Drucken im ersten Durchgang erzeugte Vorderseite heißt Schöndruck, der zweite Druckgang wird als Widerdruck bezeichnet.
Schrotschnitt
Eine Sonderform des Metallschnitts, bei dem die Umrisslinien durch Stichel in die Metallplatte getrieben werden. Größere Flächen werden durch mit Punzen eingeschlagene Linien, Sternchen, Punkte etc. aufgelockert. Auf diese Weise erscheinen die formbildenden Elemente im Abdruck weiß. Schrotschnitte als Buchillustrationen sind selten, der Schrotgrund (er erscheint als weiß gepunktete Fläche) findet sich häufiger in Bordüren.
Schuber
heißt der Schutzkarton (Buchfutteral) für das Buch, in den es hineingeschoben wird, so dass nur der Rücken sichtbar bleibt. Zuweilen ist er mit einem Deckel versehen, der den Buchrücken schützt. In seiner bibliophilen Ausstattung ist der Schuber mit Buntpapier oder Leinen bezogen und kann innen mit weichem Leder oder Flanell gefüttert sein. Gelegentlich sind die Kanten mit Leder bezogen.
Schutzumschlag
Zunächst war der Schutzumschlag das was die Bezeichnung ausdrückt, ein einfacher Papierumschlag um den Einband, der vor Schmutz und Ausbleichen schützen sollte. Bei Büchern aus der zeit vor 1900 waren Schutzumschläge die Ausnahme. Waren anfangs bestenfalls Buchtitel oder Autorenname aufgedruckt oder gestempelt, so entwickelte sich der Schutzumschlag im Laufe der Zeit immer stärker zum Werbeträger. Da er häufig empfindlich ist und zudem wichtige Hinweise auf die Auflage liefern kann, hat er sich ? besonders im angelsächsischen Raum ? als stark preisbestimmendes Qualitätsmerkmal für viele antiquarische Bücher etabliert. Die gebräuchliche Abkürzung ist SU, bzw. in englischen Texten DJ (dust jacket).
Schwanz
Im Zusammenhang mit Bucheinbänden der untere Teil des Buchrückens, im Gegensatz zum Kopf.
Schwarte
Schimpfname für altes Buch, insbesondere wenn es in Schweinsleder gebunden ist.
Schweinsleder
Wegen seiner Dauerhaftigkeit und Schönheit ein gerne genutztes Material für Bucheinbände. Besonders häufig wurde es für die blindgeprägten deutschen Einbände der Renaissance verwendet. Es hat eine bräunliche bis weiße Farbe und ist gut an den tiefen, wie gestochen wirkenden Narben zu erkennen, in denen die Borsten saßen.
Sedez
(lat. "Sechzehner"). Formatbezeichnung. Wird ein Druckbogen so gefalzt, dass daraus 16 Blatt entstehen, wird das Format Sedez genannt. Es ist also relativ klein (unter 15 Zentimeter Rückenhöhe).
Seidenband
Ein Buch, dessen Deckel mit Seide bezogen sind. War besonders für Almanache und Gesangbücher, edle genealogische Werke und literarische Prachtwerke beliebt.
Selbstverlag
Erfolgt die Vervielfältigung und Verbreitung eines Werks nicht durch einen Verlag, sondern durch den Autor persönlich, erscheint das Buch im "Selbstverlag des Verfassers".
Separata
Vgl. Sonderdrucke.
Siebdruck
Ein seit etwa 1940 entwickeltes Schablonendruck-Verfahren, auch als Seriegraphie bezeichnet. Es wird gerne für flächig wirkende Graphiken (Plakate) gewählt und kann auf vielen Materialien (Papier, Blech, Glas, Textilien) angewendet werden. Die Farbe wird durch ein Sieb (feinmaschiges Textilo- der Drahtgewebe) gedrückt, auf dem die nichtdruckenden Stellen durch Schablonen abgedeckt sind. Zunächst benutzte man nur geschnittene Schablonen, später kamen photographische Verfahren zur Herstellung der Druckformen hinzu.
Signatur
1: Unterschrift auf einem Brief, die Namensunterschrift oder das Zeichen eines Künstlers auf seinem Werk. 2: Die kleine Hilfsziffer am unteren Rand des Satzspiegels auf Seite 1 und 3 eines Druckbogens, mit der die richtige Reihenfolge der Bogen gekennzeichnet wird (Bogensignatur). 3: Im Bibliothekswesen die Standortbezeichnung für ein Buch, angebracht auf dem Buchrücken und meist auch innen im Deckel. 4: Die Einkerbung an der Längsseite der Lettern, die dem Schriftsetzer deren richtige Lage anzeigt.
Signet
Drucker- oder Verlegerzeichen, Haus- oder Gewerbemarke. Vielfach graphisch gestaltet. Vorläufer des Verlagssignets waren die Druckermarken.
Silbereinband
Bucheinbände, deren Deckel kunstvoll mit Silberarbeiten geschmückt sind oder die in seltenen Fällen ganz aus Metall bestehen. Beliebt war der Silberdurchbruch über einem Samtgrund.
Softcover
auch Paperback, entspricht im Deutschen broschiert oder kartoniert. Stark verallgemeinernde Einbandbeschreibung, die nur bei verlagsneuen Bücher ihr Berechtigung hat. Bei Beschreibungen antiquarischer Bücher sollte unbedingt sehr viel genauer spezifiziert werden, z.B. Umschlag (= Papier), Kart. (= Karton), brosch., etc. Vgl. auch Hardcover.
Sonderdruck
Von einzelnen Beiträgen aus Sammelwerken und vor allem Zeitschriften werden verschiedentlich Sonderdrucke hergestellt. Die Autoren erhalten sie oft an Stelle von Freiexemplaren. Die Paginierung kann vom Originalwerk übernommen sein, die Sonderdrucke können aber auch eine eigene Seitenzählung erhalten und sind meist mit einem eigenen Titelblatt ausgestattet.
Sortimentsbuchhandel, Sortiment
Die Sparte des Buchhandels, die in Ladengeschäften verlagsneue Bücher anbietet. Obwohl in Lehrbüchern für den Buchhandel stets von drei Geschäftszweigen die Rede ist (Sortiment, Zwischenbuchhandel, Verlag) und das Antiquariat dort stillschweigend dem Sortiment zugerechnet wird, stimmt dies mit dem Wortgebrauch nicht überein. Im Sortiment handelt man im Gegensatz zum Antiquariat ausschließlich mit neuen Büchern.
Spalte
Ist der Text einer Seite in mehrere nebeneinander stehende Streifen geteilt, nennt man einen davon Spalte.
Sperrung (Spatium, spationieren)
Wörter oder Textteile können hervorgehoben (gesperrt) werden, indem man den Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben vergrößert. Da dies beim Schriftsatz durch das Einfügen von Blindstücken (Spatien) geschieht, nennt man das Sperren auch Spationieren.
Spritzpapier
(Kiebitzpapier), eine schlichte aber wirkungsvolle Form des Buntpapiers, das durch verschiedene Spritzverfahren (Sieb und Bürste oder Spritzpistole) hergestellt wird. Besonders auf Buchdeckeln aus der zweiten Hälfte des 18. und vom Beginn des 19. Jahrhunderts häufig anzutreffen. Spritzpapiere haben einen einfarbigen Grund und ein aufgespritztes (gesprenkeltes) Muster aus einfachen Farbspritzern. Dazu zählt das Kiebitzpapier. Es wird so genannt, weil es einem Kiebitzei ähnelt (dunkles Sprenkelmuster auf sandfarbigem Grund). Die gebräuchlichsten, dunkel gesprenkelten Papiere auf ockerfarbigem Grund konnten von den Buchbindern leicht selbst hergestellt werden und waren dementsprechend weit verbreitet, zumal sie große Ähnlichkeit mit dem besonders in Frankreich beliebten ebenfalls gesprenkelten Kalbsleder hatten. Zu den Spritzpapieren gehört darüber hinaus das Gustav-Marmor, bei dem mit Säure versetzte Farbe auf farbigen Kleistergrund relativ dicht aufgespritzt wird. Durch die Säure wird die Farbe in den Spritzern zum Rand hin getrieben. Dieses Buntpapier mit glänzender Oberfläche kann man maschinell herstellen.
Stahlstich
Ein Tiefdruckverfahren, das sich im 19. Jahrhundert schnell verbreitete, da es wegen des härteren Materials erheblich höhere Auflagenzahlen erlaubte als der Kupferstich. Eine Stahlplatte wurde zunächst durch Ausglühen (Dekarbonisieren) weich und bearbeitungsfähig gemacht und dann in gleicher Weise wie der Kupferstich bearbeitet, wobei das feine Gefüge des Stahls eine wesentlich feinere Linienführung ermöglichte. Vor dem Drucken musste die Platte wieder gehärtet werden. Stahlstichillustrationen sind im Allgemeinen auf eine einfarbige Illustrationswirkung abgestimmt. Graue Flächen in Stahlstichen weisen unter der Lupe klare, gleichförmige Linien auf. Als Buchillustration wurden die Stahlstiche durch Autotypie und Strichätzung verdrängt.
Standardwerk
Ein mustergültiges, sehr gut eingeführtes und bewährtes Werk. Wird besonders als Kennzeichnung für maßgebliche, wissenschaftliche Werke gebraucht.
Stege
Die Seitenränder im fertigen Buch: Der obere Rand heißt Kopfsteg, der untere Fußsteg, der Rand zur Mitte des Buches, wo es gebunden ist, heißt Bundsteg und der Außenrand Außensteg. Beim Schriftsatz waren Stege die größeren Stücke des Blindmaterials, das zum Füllen von Leerräumen diente.
Stehkanten
sind eigentlich die beiden unteren Deckelkanten, auf denen das Buch steht. Die Bezeichnung wird aber auch generell für die Kanten an den anderen Schnittseiten des Buches verwendet.
Steindruck
Ein Druckverfahren, bei dem von einem lithographischen Stein gedruckt wird. Meist ist der Flachdruck, die eigentliche Lithographie damit gemeint. Das Wort "Steindruck" kann aber auch Hochdruck oder gravierte Steine als Druckform bezeichnen.
Stereotypie
Ein Verfahren zur Abformung von Schriftsatz oder Druckstöcken mit allen Feinheiten in Gips oder Papiermatrizen, den Matern. Die Herstellung der Matern ist verhältnismäßig billig. Von einer guten Mater kann man 15 bis 20 Stereotypieplatten gießen. Außerdem sind sie sehr lagerungsbeständig. Aus diesem Grund erlangten die Matern große Bedeutung für die unveränderte Neuauflage von Büchern, die man dann als Stereotypieausgabe bezeichnete.
Stichwort
Das wesentlichste, sinnfälligste Wort aus einem Buchtitel, das als Ordnungswort, zumeist für die Bibliographie oder für ein Stichwortregister verwendet wird. Im Gegensatz zum Schlagwort muss das Stichwort im Titel enthalten sein.
Stockflecken
Gelbliche bis dunkelbraune Flecken im Papier, die durch Bakterien hervorgerufen werden. Sie werden durch Wärme und Feuchtigkeit begünstigt.
Streicheisen
Eines der ältesten Werkzeuge des Buchbinders. Der lange Holzgriff des Streicheisens wird in die Achsel gestemmt, der metallische Stempelteil gleitet mit starkem Druck über das Leder und erzeugt eine oder mehrere Linien gleichzeitig. Das Streicheisen wird für den Blinddruck gebraucht. Sollen die Linien vergoldet werden, verwendet man die Filete.
Stundenbücher
Im Gegensatz zum Brevier sind Stundenbücher (Livres d'heures) für Laien bestimmte Erbauungs- und Gebetbücher der katholischen Kirche zu Ehren der Gottesmutter, deswegen auch Horae Beatae Mariae Virginis genannt. Der Name kommt von den darin enthaltenen Gebeten, die für die verschiedenen Stunden bzw. Tageszeiten bestimmt sind. Stundenbücher waren im 15. Jahrhundert und zu Beginn des 16. Jahrhunderts besonders beliebt. Es gibt sowohl handgeschriebene als auch gedruckte Stundenbücher, oft sind sie reich illustriert.
Subskription
(lat. subscribere = "unterschreiben"). Die Sitte, bei größeren oder nicht leicht verkäuflichen Werken verpflichtende Bestellungen schon vor dem Erscheinen aufzunehmen. Zweck der Subskription ist es, die Auflagenhöhe zu ermitteln und die Kostendeckung wenigstens zu einem Teil zu sichern. Die Liste der Subskribenten wurde früher meist im Werk bzw. dem ersten Band der Reihe veröffentlicht, was durchaus einen gewissen gesellschaftlichen Druck zur Teilnahme ausüben konnte.
Sütterlin
wird häufig als Synonym für "Deutsche Schreibschrift" benutzt. Im Grunde handelt es sich bei der "Sütterlin" jedoch um eine Sonderform der deutschen Schreibschriften. Im Jahr 1915 legte Ludwig Sütterlin (1865-1917) den Entwurf seiner Reformschrift vor, die allerdings nur von 1935 bis 1941 als Schreibschrift an den deutschen Schulen gelehrt wurde. Die Sütterlin-Schrift unterscheidet sich von der "Deutschen Schrift" bzw. der "Kurrentschrift" hauptsächlich durch die senkrechte Ausrichtung der Buchstaben und die gleichmäßige Strichstärke.
Supralibros
Das Eignerzeichen, in der Regel das Wappen des Besitzers, das (mittig) auf den vorderen Buchdeckel aufgeprägt wurde. Es diente sowohl zur Eigentumsbezeichnung als auch zur Zierde.
→ nach obenTafel
Als Tafeln bezeichnet man die Beigabe von Abbildungen in einem Buch, die auf besonderem Papier gedruckt und nicht in die Paginierung (Seitenzählung) einbezogen sind. Um die Bildqualität nicht zu beeinträchtigen, werden Tafeln meist nur einseitig bedruckt.
Taschenbuch
(Abkürzung TB) ist nicht nur eine Bezeichnung für die modernen, kleinformatigen, preiswerten Paperbackausgaben in zumeist einheitlicher Reihenausstattung, die nach 1945 in Deutschland zuerst vom Rowohlt-Verlag eingeführt wurden. Der Begriff steht auch für eine literarische Gattung. Als Nachfolge des Musenalmanachs war das Taschenbuch vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts weit verbreitet. Vorwiegend handelte es sich um eine jährlich erscheinende Veröffentlichung für die gehobene Unterhaltung. Im Gegensatz zum Musenalmanach enthielt das Taschenbuch eher Beiträge in Prosa (Romane, Novellen, Reisebeschreibungen, praktische Unterweisungen usw.). Im Internet hat sich unsinniger Gebrauch eingebürgert. Dort werden oft sogar unabhängig von der Größe vielfach alle kartonierten Ausgaben als Taschenbuch bezeichnet.
Tektur
Ein Deckblatt oder ein Papierstreifen, der auf eine zu berichtigende Textstelle im Buch aufgeklebt wird. Beispielsweise zur Aktualisierung von Gesetzestexten, Verordnungen und Satzungen oder zum Verdecken politisch unliebsamer Stellen oder zensierter Passagen. Vgl. Carton.
Textabbildung
heißt jede Abbildung, die auf dem Textbogen und in engem Zusammenhang mit dem Text steht. Auch ganzseitige, in die Seitenzählung einbezogene Bilder sind als Textabbildung zu verstehen. Da für alle anderen Bildbeigaben im Buch spezielle Bezeichnungen üblich sind (Tafel, Karte, Frontispiz, Porträt etc.), erscheint meist die Kurzform "Abbildung".
Textholzschnitt
Eine Holzschnittabbildung, die sich zusammen mit fortlaufendem Text auf einer Seite befindet (eingerückt oder freigestellt).
Tiefdruck
Alle Drucktechniken, bei denen die Teile der Druckplatte, die Farbe annehmen sollen, tief liegen, heißen Tiefdruck. Beim Einfärben der Druckform fließt die Farbe in die Vertiefungen, in die Näpfchen. Von den hochliegenden Teilen, die nicht drucken sollen, wird die Farbe abgewischt, "abgerakelt". Beim Druckvorgang saugt das Papier die Farbe aus den Näpfchen heraus. Neben den klassischen Tiefdrucktechniken wie Kupfer- und Stahlstich, Radierung und Heliogravüre gehört hierzu der maschinenmäßige Raster- oder Rakeltiefdruck, der besonders für den Zeitschriftendruck (den Druck der Illustrierten im 20. Jahrhundert) und für den Druck von Fotobildbänden verwendet wurde.
Tintenfraß
Um eine dunkle Schrift zu erzielen, enthielt die früher verwendete Eisengallustinte einen großen Sulfatanteil. Sie kann, ähnlich wie Rost, das Papier zerstören.
Titel
Im engeren Sinn die Bezeichnung eines Buchs oder einer literarischen Arbeit, also die Namensgebung derselben durch den Verfasser. Im weiteren Sinn wird Titel häufig identisch mit Titelblatt verwendet.
Titelausgabe, Titelauflage
Werden Restbestände einer Auflage mit einem neuen Titelblatt ausgestattet (um beispielsweise aktuellen Käuferinteressen besser zu entsprechen) und so ausgeliefert, nennt man das eine Titelausgabe. Gelegentlich wurde dadurch unerlaubterweise eine Neuauflage vorgetäuscht.
Titelbild
Eine Bildtafel, die dem Titelblatt gegenübersteht. Bei älteren Büchern wird das Titelbild Frontispiz genannt.
Titelblatt
Das Titelblatt, auch Drucktitel oder einfach Titel genannt, trägt den Titel und eventuellen Untertitel, den Namen des Verfassers, die Namen von Herausgebern, Übersetzern, Bearbeitern, die Auflagenbezeichnung, Band- und Abteilungsnummer, Abbildungs- oder Tafelzahl, Verlag, Signet, Erscheinungsort und Jahr. Bei Abweichungen zwischen Angaben auf dem Einband und dem Titelblatt ist die Fassung auf dem Titelblatt ausschlaggebend.
Titelei
Die dem Buchtext vorangehenden Teile (Schmutztitel, Titelblatt, Privileg, Vorwort, Geleitwort, Inhaltsverzeichnis usw.) bezeichnet man als Titelei.
Titelkupfer
Ein in das Titelblatt eingedruckter Kupferstich oder auch das ganzseitige, dem Titelblatt gegenüberstehende Kupfer (Frontispiz). Ist das Titelkupfer von kleinem Format, spricht man üblicherweise von der Titelvignette. Ist das gesamte Titelblatt in Kupfer gestochen, spricht man von gestochenem Titel oder Kupfertitel.
Titelvignette
Ein auf dem Titelblatt angebrachtes, eigentlich rein ornamentales Zierstück (Vignette), vielfach aber auch mit figürlicher Darstellung.
Tonplatte
Gelegentlich sind Graphiken auf einem zartfarbenen Grund gedruckt, der als Tonplatte oder Tondruck bezeichnet wird. Besonders bei Lithographien oder Holzstichen wird dieses Mittel gerne benutzt, um den Eindruck eines alten oder besseren Papiers zu vermitteln, um der Zeichnung Zusammenhalt oder Tiefe zu geben oder um ihr durch Lichter mehr Ausdruck zu verleihen. In der einfachsten Form ist es eine rechteckige Fläche, etwas größer als die eigentliche Abbildung. Meist verwendete man eine sehr helle, matte Farbe (häufig chamois oder hellgrau).
→ nach obenUnbeschnitten
Ein Buch wird als unbeschnitten bezeichnet, wenn dessen Buchblock vom Buchbinder nicht beschnitten worden ist. Da in diesem Zustand noch alle Falze vorhanden sind, muss das Buch zum Lesen zuerst oben und seitlich aufgeschnitten werden.
Untertitel
Bezeichnung für eine erläuternde oder ergänzende Angabe zum Haupttitel eines Buchs.
→ nach obenVakat
Eine unbedruckte Seite im Buch wird vom Setzer als vakat bezeichnet.
Velin, Velinpapier
Papier mit einer sehr gleichmäßigen Oberfläche. Ursprünglich wurde mit Velin ein sehr feines, weiches und helles Pergament bezeichnet, das man aus der Haut tot geborener Kälber gewann. Später bezeichnete man mit Velin alle besonderen Papiere. Velin wird mit einer Form geschöpft, deren Sieb aus Drahtgewebe mit quadratischen Maschen besteht, was ein gleichmäßiges Papier mit glatter Oberfläche ergibt. Im Gegensatz dazu besteht das Sieb der Schöpfform für normales (geripptes) Papier aus feinen Drahtstäben, die mit Bindedrähten zusammengehalten werden.
Verbunden
oder verheftet nennt man ein Buch, in dem z.B. ein Druckbogen fehlt oder nicht in der richtigen Reihenfolge eingebunden ist.
Versalien
Die "großen" Buchstaben einer Schrift. Sie können auch als Kapitale oder Majuskeln bezeichnet werden, im Gegensatz zur Minuskel oder Gemeine, den "kleinen" Buchstaben. Ist ein ganzes Wort in Großbuchstaben gesetzt, kann es sich auch um Kapitälchen handeln.
Verso
Die Rückseite eines Blatts. Das Gegenteil von recto.
Vignette
Kleine Zierstücke im Buch, sowohl rein ornamentale als auch bildliche Darstellungen. Besonders die Ausgaben des Rokoko sind häufig mit Vignetten geschmückt; im 19. Jahrhundert sind sie gleichfalls reich vertreten. Je nach Platzierung unterscheidet man Titelvignette, Kopfvignette (Fleuron) und Schlussvignette (Cul-de-lampe).
Vorabdruck
ist die ganze oder teilweise Veröffentlichung eines schriftstellerischen Werks in einer Zeitschrift oder Zeitung, bevor das Werk in Buchform erscheint. Im verlagsrechtlichen Sinn gilt das Werk trotz des Vorabdrucks noch nicht als "erschienen". Die Buchausgabe darf dann also als Erstausgabe bezeichnet werden.
Vordatiert
Um ein Werk nicht zu schnell veralten zu lassen, werden Bücher, die am Ende eines Jahres erscheinen, oft bereits mit der neuen Jahreszahl versehen. Eine handschriftliche "Weihnachtswidmung" im Jahr vor dem im Druck angegebenen Erscheinungsjahr ist also nicht ungewöhnlich.
Vorsatz
Als Vorsatz werden die dem Buch vor- und nachgehefteten Blätter bezeichnet, die nicht zu den Druckbogen gehören. Im Allgemeinen besteht das Vorsatz aus zwei Blättern, dem an den Deckel geklebten Spiegel und dem "fliegenden Blatt". Das Vorsatzpapier sollte mindestens ebenso schwer sein wie das Textpapier und möglichst fest und zäh. Vielfach wurden Buntpapiere als Vorsatz verwendet.
Vorstücke
Gleichbedeutend mit Titelei, wird diesem Begriff aber besonders dann vorgezogen, wenn der Umfang mehr als nur wenige Seiten umfasst.
Vortitel
Gleichbedeutend mit Schmutztitel.
Vorzugsausgabe
Üblich sind Vorzugsausgaben insbesondere bei bibliophilen Drucken (Liebhaberausgaben), die nur für einen kleinen Interessentenkreis (meist in nummerierter Auflage) hergestellt werden und von denen oft ein Teil der Auflage auf besseres (großes) Papier gedruckt wird. Vorzugsausgaben haben eine besondere Ausstattung, sind meist mit höherwertigen (z.B. kolorierten) oder zusätzlichen Illustrationen und eventuell mit Originalen versehen. Auch die Einbände sind üblicherweise kostbar gestaltet. In vielen Fällen sind die Besonderheiten der Ausstattung im Impressum vermerkt. Bei sehr alten Werken, besonders wenn sie illustriert waren, wurde gelegentlich eine sehr kleine Anzahl in ähnlicher Weise bevorzugt ausgestattet, hierfür ist dann oft die Bezeichnung "Fürstenexemplar" zu finden.
→ nach obenWaschzettel
Kurze Darstellung von Inhalt und Zweck eines Buches, als Zettel vom Verleger den Rezensionsexemplaren beigegeben. Auch die Laschen des Schutzumschlags, die häufig diese Informationen tragen, werden als Waschzettel bezeichnet.
Wasserfleckig
Papier reagiert besonders empfindlich auf Feuchtigkeit. Unter deren Einfluss kann es aufquellen, kann sich die Oberfläche verändern, darin enthaltene Partikel oder die Patina können durch Kapillarwirkung zur Grenze des feuchten Bereichs wandern und dort deutlich sichtbare Ränder bilden. All diese Erscheinungsformen nennt man Wasserflecken bzw. bei farblichen Veränderungen Wasserrand.
Wasserzeichen
Vor 1800 auch Papierzeichen genannt. Wasserzeichen sind durchscheinende Figuren, Muster oder Buchstaben im Papier, die als Markenzeichen eingefügt wurden. Diese etwas dünneren Papierstellen können in unterschiedlichster Weise erzeugt werden. Meist sind es Drähte, die auf das Schöpfsieb bzw. das Rundsieb der Papiermaschine aufgenäht oder gelötet werden. Sie können aber auch durch Stempel ins noch feuchte Papier oder durch Prägung im fertigen Papier angebracht sein. Aufwendiger sind die Schattenwasserzeichen, bei denen es sowohl dickere als auch dünnere Stellen im Papier gibt. Diese sind in Velinpapier, Banknoten, Wertpapieren etc. zu finden. Sehr viele abendländische Papiere weisen Wasserzeichen auf, sie können ein wichtiges Hilfsmittel bei der Datierung oder der Unterscheidung echter und gefälschter Ausgaben sein. Bei bibliophilen Ausgaben werden oft unterschiedliche Papiersorten für die verschiedenen Ausgaben (Normalausgaben, Vorzugsausgaben) verwendet.
Weiß(linien)schnitt
Form des Holzschnitts, bei dem die Zeichnung in den Stock geschnitten ist (nicht aus ihm) und somit in den Abdrucken weiß erscheint. Auch Schrotblätter gehören zu den Weißschnitten.
Werkdruckpapier
Eine große Gruppe von Papieren, deren Oberfläche sich gut für den Schriftdruck (Buchdruck) eignet, auf denen aber nur recht grobe Bilder abgedruckt werden können. Meist sind sie relativ voluminös, um auch dünneren Büchern ein "gewichtiges" Aussehen zu verleihen.
Widmungsexemplare
sind Bücher mit einer handschriftlichen persönlichen Widmung des Autors. Bei jüngerer belletristischer Literatur gibt es sie in vielfältiger Form. Im strengen Sinn sind damit Exemplare gemeint, die vom Autor überreicht wurden und einen entsprechenden Eintrag aufweisen. Bei wissenschaftlichen Arbeiten ist es üblich, sich mit solchen Freiexemplaren bei Fachkollegen und Vorgesetzten zu bedanken oder sich damit vorzustellen. Hierfür findet man häufig die Bezeichnung Dedikationsexemplar. Oft wurden Widmungsexemplare als Vorabexemplare an einflußreiche Persönlichkeiten versandt, um bei Erscheinen des Werkes eine Empfehlung oder wohlwollende Kritik vorlegen zu können.
Wiegendruck
Druckerzeugnis aus den Jahren unmittelbar nach Erfindung der Buchdruckerkunst. Vgl. Inkunabel.
Wurmstich
Bücherschäden, die durch nagende Insekten verursacht werden. Besonders der früher verwendete Kleister aus Stärke oder Mehl machte die Bücher anfällig. Deshalb sind die Wurmspuren auch vornehmlich vom Rücken ausgehend zu finden, den Stellen, wo der Kleister eingesetzt wurde.
→ nach obenXylographie
(griech. Xylo = "Holz"). Hauptsächlich im 19. Jahrhundert gebrauchte Bezeichnung für Holzschnitt und besonders für Holzstich.
→ nach oben → nach obenZinkdruck, Zinkographie
Ein Flachdruckverfahren, weitgehend identisch mit der Lithographie, nur dass der Lithographiestein durch eine Zinkplatte ersetzt wird. Im Gegensatz zum Offsetdruck wird beim Zinkdruck kein Gummituch als Zwischenschritt genutzt. Der Zinkdruck ist also ein direktes Druckverfahren, bei dem die Zeichnung auf der Druckform seitenverkehrt stehen muss (beim Offset seitenrichtig). Ein Zinkdruck macht oftmals einen etwas flauen, leicht unscharfen Eindruck.
Zimelien
(griech. Kleinodien). Kostbare Stücke mit besonderer Ausstattung oder Bedeutung in Bibliotheken oder Sammlungen. Weitgehend gleichbedeutend mit Rara, den seltenen, wertvollen, empfindlichen, besonders behüteten Büchern einer Bibliothek.
Zwischentitel
Sondertitel für verschiedene Abschnitte eines Buches. Also eine Art Kapitelüberschrift, die auf einem eigenen Blatt steht. Die Zwischentitel in alten Büchern können graphisch aufwendig gestaltet sein, wie der Kupfertitel.
→ nach oben(© by Michael Trenkle, Antiquariat Patzer & Trenkle, Konstanz)
![]()
![]()
Nach oben
- Startseite
- Kontakt
- AGB
- Datenschutz
- Impressum
- Newsletter
- Links
(c) Copyright 2004-2025 by GIAQ - Alle Rechte vorbehalten